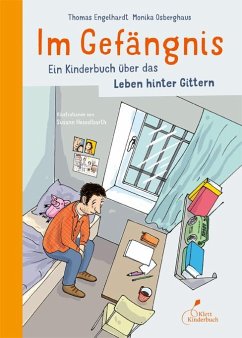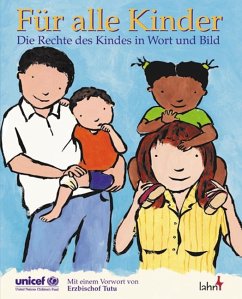über das Internet, bei Reisen oder als Migranten in Kontakt zu kommen. Und neben den stereotypen Heuschrecken, Haien und Halunken der Weltwirtschaft werden auch Unternehmer gezeigt, die von den Folgen der Globalisierung in die Bredouille gebracht werden.
Schneiders Werk könnte also ein Schulbuch sein: mit seiner Ausgewogenheit und Tiefe, sogar mit seiner Aufmachung, den grau unterlegten Zitaten und begleitenden Karikaturen. Aber vielleicht auch im Urteil seiner jugendlichen Leser, die sich in ihrer Freizeit lieber etwas lebendiger - und womöglich engagierter - informieren ließen. "In den Zeiten der Globalisierung sollte man die Gestaltung unserer Welt nicht nur den Politikern und schon gar nicht den Wirtschaftsbossen alleine überlassen", schreibt Schneider abschließend. Deutlicher und direkter wird er nicht: "Wenn dieses Buch einige Anregungen zum Wissenwollen und Mitgestalten gegeben hat, wurde es jedenfalls nicht umsonst geschrieben - und gelesen!"
Ganz anders geht Klaus Werner-Lobo die Sache an. Vor sieben Jahren hatte er zusammen mit Hans Weiss in einem "Schwarzbuch Markenfirmen" internationale Konzerne mit Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in Entwicklungsländern in Verbindung gebracht. Das angenehm sachlich gehaltene Buch erregte einiges Aufsehen. Und erstaunlicherweise hat bis heute keine der diskreditierten Firmen geklagt. Jetzt hat der Autor mit "Uns gehört die Welt!" ein Buch veröffentlicht, um Jugendlichen Anlass und (über eine eigens eingerichtete Website) Gelegenheit zu bieten, gegen die dargestellten Missstände Stellung zu beziehen.
"Dieses Buch wird euch zornig machen", verspricht Werner-Lobo. Und er hat recht. Als er nämlich auf der dritten Seite seines Vorworts beteuert, sein Ziel sei es, "dass ihr euch am Ende selbst eure Meinung bilden und danach handeln könnt", ist es bereits zu spät. Gleich im ersten Absatz hat Werner-Lobo mit der schlichten Behauptung, Millionen Menschen stürben in Kriegen, "damit große Firmen Waffenhandel betreiben und an wertvolle Rohstoffe gelangen können", einen agitatorischen Tiefschlag gelandet, von dem sich das Buch nicht mehr erholt. Zumal ihm noch ganz andere problematische Verkürzungen und Ungenauigkeiten folgen.
Gewissenlose Konzerne, korrupte Politiker, hemmungslose Superreiche: mit großer Geste führt Klaus Werner-Lobo durch das Gruselkabinett der Globalisierungskritik. Dabei ist immer noch beeindruckend, wenn der Autor schildert, wie er sogar Mitarbeiter des Bayer-Konzerns für fingierte Geschäfte mit Rohstoffen aus Afrika interessieren konnte, deren krimineller Hintergrund förmlich zu riechen war. Die juristisch offenbar stichfesten Formulierungen in kritischen Kurzporträts von zwanzig Firmen - darunter zielgruppenrelevante Konzerne wie Adidas oder H&M, Apple oder Nokia, Disney oder Mattel, Coca-Cola, McDonald's oder Nestlé - zeigen, dass Werner-Lobo durchaus mit der gebotenen Sorgfalt schreiben kann. Nur verzichtet er eben für den aktionistischen Effekt immer wieder auf Genauigkeit. Er schwächt damit sein Buch - und seine jungen Aktivisten, wenn sie sich, mit seinen Darstellungen gerüstet, im Detail widerlegen lassen müssen.
Eine überzeugende Balance zwischen Sachlichkeit und Lebendigkeit, Information und Initiative hat der Autor Wolfgang Korn in seinem Buch "Die Weltreise einer Fleece-Weste" gefunden. Anders als Pietra Rivoli vor drei Jahren in ihrem "Reisebericht eines T-Shirts" betreibt der Autor seine Tour als gut recherchiertes Gedankenspiel, und anders als die amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin landet er nicht bei allgemein ökonomischen Überlegungen, sondern da, wo er begonnen hat: bei sich selbst. Im Fernsehen sieht er, wie afrikanische Flüchtlinge mit dem Boot auf den Kanaren stranden. Einer von ihnen trägt eine rote Weste mit Fleck, und der Autor muss an sein zum Verwechseln ähnliches Kleidungsstück denken, das neulich erst mit Rotweinspuren in die Altkleidersammlung ging. In der Weste hat Wolfgang Korn den Hauptdarsteller für seine "kleine Geschichte über die große Globalisierung" gefunden: Er schildert den Weg der Weste vom Rohstoff zum Recycling, von der Ölförderung in Dubai über die Polyesterproduktion, die Fleece-Weberei und die Nähfabrik in Bangladesh, die Containerhäfen in Singapur und Hamburg bis in den eigenen Kleiderschrank - und von dort über den Altkleidercontainer auf einen Markt in Dakar, wo sie ein senegalesischer Junge kauft, um für seine Flucht nach Teneriffa gerüstet zu sein.
Korn erzählt nicht nur von den Stationen seiner Weste, sondern immer wieder auch von Menschen in ihrer Nähe. Sei es der 13-jährige Araber, dessen internationalen Ausbildungsweg seine wohlhabende Familie bestimmt, sei es der bengalische Arbeiter, der nach einer Demonstration für bessere Arbeitsbedingungen zusammengeschlagen wird und am nächsten Morgen doch kleinlaut wieder vor der Fabrik steht oder ebender junge Senegalese mit seinem Traum vom besseren Leben in Europa und dem Albtraum der Flucht. Es sind Geschichten. Aber sie erhellen schlaglichtartig, was Globalisierung für den Einzelnen bedeuten kann.
Und das Beste kommt zum Schluss. Am Ende seines Buches nämlich wird Korn nicht nur missionarisch, sondern persönlich. Seine Erkenntnis: "Ich hätte vorher nachfragen müssen." Nach der Herkunft der Fleece-Weste, die er da kaufen will, nach ihren Produktionsbedingungen, nach Energieverbrauch und Umweltbelastung. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Die Leser dieses Buches sind es übrigens auch. Und gut unterhalten noch dazu.
Gerd Schneider: "Globalisierung". Bibliothek des Wissens. Arena Verlag, Würzburg 2008. 149 S., br., 8,95 [Euro]. Ab 12 J.
Klaus Werner-Lobo: "Uns gehört die Welt - Macht und Machenschaften der Multis". Carl Hanser Verlag, München 2008. 256 S., br.., 16,90 [Euro]. Ab 12 J.
Wolfgang Korn: "Die Weltreise einer Fleece-Weste. Eine kleine Geschichte über die große Globalisierung". Bloomsbury Verlag, Berlin 2008. 168 S., geb., 14,90 [Euro]. Ab 12 J.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
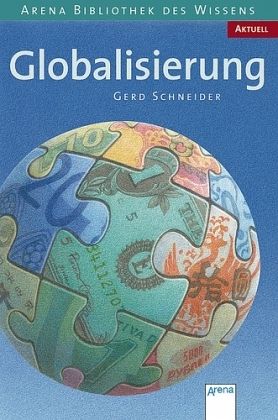




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2008