seinem Buch über Berninis Papst- und Herrscherporträts die Frage, ob sich im Porträt gesellschaftliche Normen widerspiegeln und damit das Individuelle sich auf die Physiognomie beschränke. Zitzlsperger entwickelt seine These anhand der klerikalen Gewänder, die Ausdruck der Selbstbehauptung im vatikanischen Hofzermoniell seien.
1549 starb Papst Paul III. Sein Grabmal in Sankt Peter von Guglielmo della Porta brach mit der Tradition. Zum ersten Mal wurde der Vertreter Petri ohne Tiara und ohne Pontifikalschuhe dargestellt. Er trägt nur die gewöhnliche Priesterkleidung: Pluviale, Stola und Albe. Seine Hand erhebt er nicht etwa segnend, sondern zum Friedensgruß wie die Reiterstatue des Marc Aurel. Mit diesem Antikenzitat ließ sich Paul III. als Friedensstifter feiern. Der Verzicht auf eindeutige Insignien entsprach der Forderung der Gegenreformation nach Selbstbescheidung. Das geneigte, entblößte Haupt sollte zudem an das päpstliche Gebet erinnern, an die Devotion vor Gott.
Bernini hat den "Humilitastypus" in seinen frühen Papstbüsten übernommen. Paul V. und Gregor XV. neigen beide leicht den Kopf. Doch die große Zeit seiner Papstporträts beginnt mit dem Pontifikat Urban VIII. Dreizehnmal hat er seinen Gönner in Marmor gemeißelt und in Bronze gegossen. Die Papstbüste wird zum Staatsporträt, zum Medium der Propaganda. Die Bescheidenheit ist dahin. Urban hebt stolz den Kopf. Die Mimik ist belebt. Die Marmorbüste in San Lorenzo in Fonte ist das früheste Beispiel für diesen Wandel. Für den alternden Urban hat Bernini 1632 noch eine weitere Form der Repräsentation gefunden, den "Camaurotypus". Der Camauro, die außerliturgische Kopfbedeckung, zählte seit dem späten fünfzehnten Jahrhundert zum päpstlichen Ornat. Sie trug der Papst bei Audienzen zusammen mit der Mozzetta, einem kurzen Schultermantel und darunter dem Rochett aus plissiertem Leinen, das die Albe ersetzte. Das Rochett war - bevor es von Johannes XII. zum päpstlichen Untergewand erklärt wurde - den Richtern der Sacra Rota vorbehalten gewesen. In der Kombination mit dem Rochett wurde deshalb die Mozzetta nach dem Schisma zum "Signum Iurisdictionis" erklärt. Das Ornat signalisierte die höchste geistliche und weltliche Rechtsprechung.
Urban gab das Porträt in Auftrag, als er im Dreißigjährigen Krieges nach Castel Gandolfo geflohen war. Den Konflikt begriff er nicht konfessionell, sondern rein politisch. Von ihm ist der Ausspruch überliefert, er sei "lieber Fürst als Papst". Er unterstützte die Franzosen, um den Habsburgern zu schaden, und nahm dafür das französische Bündnis mit dem protestantischen Schweden in Kauf. Kardinal Borgia machte Urban für die Erfolge der Schweden verantwortlich und löste dadurch einen Tumult im Kardinalskollegium aus. Urban war seines Lebens nicht mehr sicher und suchte Schutz in Castel Gandolfo. Dort bereitete er die Säuberung des Kardinalskollegiums vor und plante die Wiederherstellung seines Ansehens als Oberhaupt der Kirche.
Bernini verlieh dem wiedererstarkten Papst ein neues Gesicht. Gleichzeitig befahl Urban dem Bildhauer, eine Büste des Kardinals Scipione Borghese zu meißeln, um diesen für seine Sache zu gewinnen. Der Unterschied zum Papstporträt könnte nicht größer sein: dort der strenge Oberhirte, hier der joviale Hofmann. In seiner Mozzetta scheint Scipione zu schweben. Der Mund ist sprechend geöffnet. Den kompositorischen Gegensatz von Papst und Hofmann glaubt Zitzlsperger in den Porträts Karls I. von England und des Höflings Thomas Baker wiedergefunden zu haben. Baker sah vermutlich die Büste des Königs in Berninis Atelier und bestellte daraufhin seine eigene. Unter Berninis Händen entstand das Abbild eines modischen Gecken. Das üppige Haar ist stark unterschnitten - eine Perücke, die die Liebeslocke schmückt. Baker trägt ein raffiniert durchbrochenes Spitzenjabot. Auch die Büste des Königs muß Bernini mit großer Virtuosität gemeißelt haben. Sie war so filigran, daß sie zum Schutz in einen Seidenbeutel gehüllt wurde. 1689 wurde sie beim Brand des Whitehall Palace zerstört. Sie ist durch einen Stich und eine Kopie überliefert, die aber nur ein unscharfes Bild von ihr geben.
Zitzlsperger meint hingegen ein Abbild des Originals in einer Terrakottabüste Karls I. gefunden zu haben, die in den Courtauld Institutes Galleries London aufbewahrt wird. Doch er vermag damit nicht zu überzeugen. Das, was Baker an der Büste seines Königs faszinierte und ihn zu einem eigenen Auftrag veranlaßte, sucht man vergebens. Die Büste in London ist blockhaft, Kopf und Rumpf scheinen miteinander zu verschmelzen. Bernini hat beklagt, daß er Karl I. nicht persönlich studieren konnte. Die Büste meißelte er nach einem Tripelporträt Antonius van Dycks. Als Bernini sie Ludwig XIV. entwarf, erklärte er, daß die Büste "heroisch" werde. Er hat dem König größere Augen und eine gerundete Gesichtskontur verliehen. Außerdem legte er die Stirn frei und formte die Locken nach den Bildnissen Alexanders des Großen. Bernini schuf eine unvollkommene Ähnlichkeit, aber eine vollendete Physiognomie. Die Kritik verstummte. Die Höflinge imitierten die neue Alexanderfrisur. Sie strichen die Locken aus der Stirn.
BETTINA ERCHE
Philipp Zitzlsperger: "Gianlorenzo Bernini". Die Papst- und Herrscherporträts. Zum Verhältnis von Bildnis und Macht. Hirmer Verlag, München 2002. 215 S., 106 Abb., geb., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
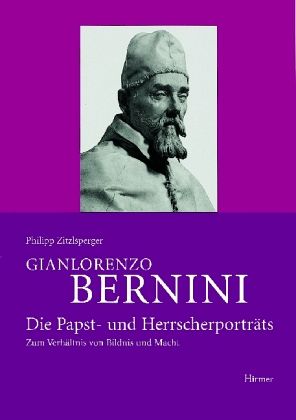




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.09.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.09.2002