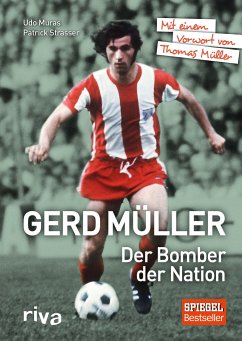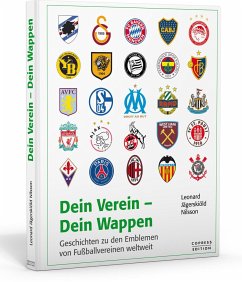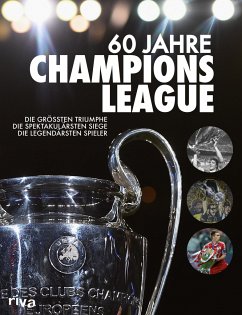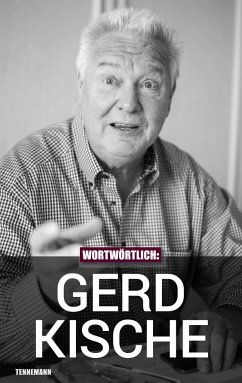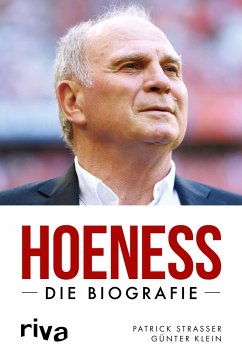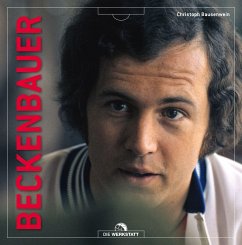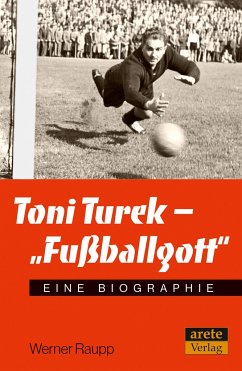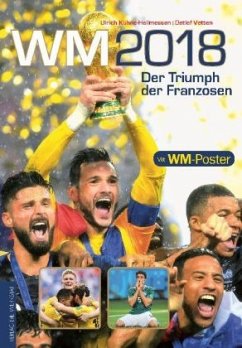breit recherchierte und methodisch anspruchsvolle Biographie, die den Blick über das rein Sportliche und Persönliche der Stars hinaus wagt und auch die Welt jenseits des Rasenvierecks reflektiert. "Gerd Müller oder wie das große Geld in den Fußball kam" hat er sein Buch benannt.
Vieles aus der großen Zeit der Müllers, Beckenbauers und Maiers ist längst Legende: der märchenhafte Aufstieg der Jungs aus der Nachkriegstristesse in den internationalen Jet-Set, das Leben in den Klatschspalten und die teils bis heute unerreichten Rekorde. Dass es in den ersten Jahren des kommerziellen Profifußballs finanziell alles andere als koscher zugegangen ist, war irgendwie schwer zu leugnen, doch nachbohren wollte eigentlich niemand.
Als der junge Gerd Müller 1964 nach München kam, war er ein typisches Kind seiner Generation. Ein paar Monate nach Kriegsende in Nördlingen geboren, wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf. Der Vater erst Tagelöhner, später Fahrer einer Kohlen- und Lumpenhandlung, die Mutter kümmerte sich um die vier Kinder. Die Schule hatte den jungen Gerd nie groß interessiert und erst recht keine Erfolge gebracht. Sicher fühlte sich der junge Müller vor allem auf dem Fußballplatz, wo nichts zählte als sein Talent und der unbändige Wille. Beim TSV Nördlingen wurde er bald aus dem Umfeld des FC Bayern entdeckt, der damals zwar noch im Schatten seines Lokalkonkurrenten TSV 1860 München stand, aber dem Nachwuchstalent offenbar bessere Perspektiven bieten konnte. Und wo Müller bald viel Geld verdienen sollte, zumindest unter der Hand.
Müller war nicht der Einzige, die ganze Liga fußte damals auf einem System von schwarzen Zahlungen. Denn die Funktionäre des deutschen Fußballs hatten sich Anfang der sechziger Jahre zwar dazu durchgerungen, den Weg zum Profitum zu gehen. Doch hing man hierzulande nach außen weiter an der idealisierten Vorstellung, dass der Fußballsport eine "saubere" Sache sei und von den Gesetzen des Mammons freigehalten werden müsse. Die wirklichen Gründe waren freilich nicht nur ideeller Art. Denn was auf dem Spiel stand, war die Gemeinnützigkeit der Vereine, ohne die deftige Steuern fällig geworden wären. Um die Gemeinnützigkeit zu bewahren, wurden Gehälter und Ablösesummen streng gedeckelt - und waren damit weit entfernt von dem tatsächlichen Wert, den die Stars in einer entstehenden Medienwelt entwickelten.
Beinahe logische Folge dieser Kluft zwischen tatsächlichem Wert und realen Gehältern war ein System schwarzer Kassen und Zulagen. Die Bayern-Führungsriege um Manager Robert Schwan, eine Gruppe von Männern, die über ihre Vergangenheit lieber schwiegen und in den Wirren der Nachkriegszeit zu Geld und Einfluss gekommen waren, erkannte das wirtschaftliche Potential des Fußballs früher als andere. Doch Sponsoring und Einnahmen aus Fernsehübertragungen und der Werbung waren noch Zukunftsmusik. Als einzig verlässliche Erlösquelle blieben Gastspiele und zum Teil ausgedehnte Auslandstourneen in Sommer- und Winterpause. Auf diesen Reisen kassierte Manager Schwan laut Woller hohe DM- und Dollar-Summen ein, immer in bar und nie regulär verbucht. Der größte Anteil ging in Briefumschlägen direkt an die Spieler, mit "dicken Bündeln" seien sie zurückgekehrt, berichtete Beckenbauer später.
Alles lief diskret, auch die regelmäßigen Zwischenlandungen in Zürich, wo ein Teil der Einnahmen sicher verblieb. Für alle Fälle sei regelmäßig "politischer Begleitschutz in Gestalt von Staatssekretär Erich Kiesl aus dem Innenministerium" dabei gewesen, schreibt Woller. Einmal soll der den verdutzten Zöllnern am Münchner Flughafen gesagt haben: "Ich bin der Staatssekretär Kiesl und das ist der FC Bayern München - also lasst uns bitte durchgehen." Die Nähe zur CSU half den Bayern-Spielern laut Woller auch später noch, als die Finanzämter Mitte der siebziger Jahre Teile der jüngeren Vergangenheit aufarbeiten. Die meisten Verfahren wurden diskret mit kleineren Nachzahlungen bereinigt, obwohl zum Teil riesige Summen hinterzogen worden waren. Dass manche Helden von damals noch heute gewisse Anpassungsschwierigkeiten an die allgemeingültige Steuermoral haben, ist da beinahe verständlich. Doch trotz Wollers Recherchen liegt noch vieles im Dunklen. Das Steuergeheimnis schützt die Akten in den Archiven und die damals Handelnden in Sport und Politik.
Müller war schnell zum großen Star aufgestiegen. Im Zirkus um die immer größere mediale Ausleuchtung des Fußballs in diesen Jahren sprang er über jedes Stöckchen und verdiente blendend. Doch auf dem gesellschaftlichen Parkett jenseits des Rasens hatte sich der Jahrhundertfußballer aus der schwäbischen Provinz nie wohl gefühlt. Von Anbeginn hatte er im Schatten der "Lichtgestalt" Beckenbauer gestanden. Noch schlimmer wurde es, als mit Uli Hoeneß und Paul Breitner eine neue Generation von Spielern nach oben kam, die sich als Fußball-Intellektuelle gaben und Maßstäbe setzten, denen Müller nicht mehr genügte. Der Rest ist Geschichte: 1979 die Trennung von den Bayern im Streit, sein spätes Abenteuer in den Vereinigten Staaten, wo er den abgearbeiteten Körper noch ein paar Jahre für viel Geld als Altstar in der amerikanischen Liga schindete, dann der wirtschaftliche Abstieg, als er all sein Geld durch zwielichtige Berater und aussichtslose Investments verlor. Schließlich der Alkohol. Sein Leben lang hatte der Müller begleitet, eine kleine Schwäche, bei der die Kollegen gerne ein Auge zudrückten. Ende der achtziger Jahre hätte ihn der Suff beinahe in der Gosse enden lassen.
Doch dann kam die letzte große Wendung im Leben des Gerd Müller - und es war ausgerechnet der FC Bayern um Uli Hoeneß, der den gefallenen Star wieder aufrichtete. Hoeneß, inzwischen Manager, brachte Müller in eine Entzugsklinik und holte ihn in die Jugendarbeit des FC Bayern. Dort wirkte er, fern der medialen Aufmerksamkeit, aber wohl zufrieden und mit größtem Einsatz, bis es ihm seine Alzheimer-Erkrankung unmöglich machte. Hoeneß, der selbst alle Härten des frühkapitalistischen Fußballs erfahren hatte, erkannte damals mal wieder vor den anderen, dass die Vereine für ihre Spieler Verantwortung tragen und dass sie empfindsame Wesen wie Gerd Müller schützen müssen.
Hans Woller ist es gelungen, die großen Linien dieser Zeit herauszuarbeiten. Ohne künstliche Spannungsbögen und ohne jede emotionale Überhöhung gibt sein Buch einen detailreichen Einblick in diesen bisher kaum beachteten Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte.
ALEXANDER HANEKE
Hans Woller: Gerd Müller. Oder wie das große Geld in den Fußball kam.
C. H. Beck Verlag, München 2019. 352 S., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
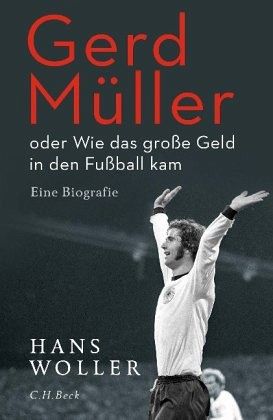





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.11.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.11.2019