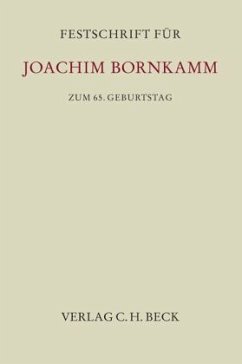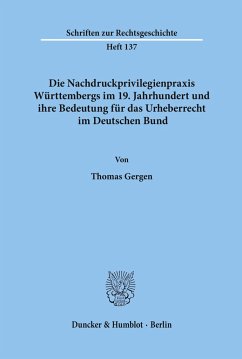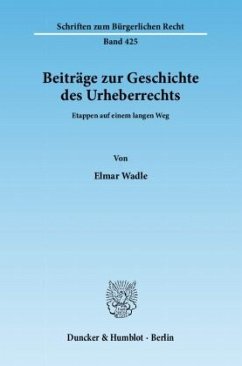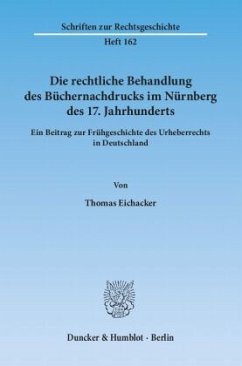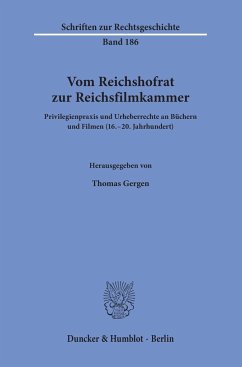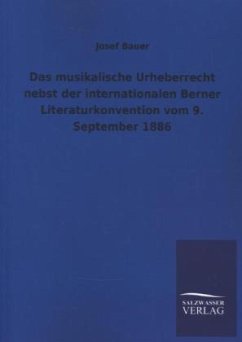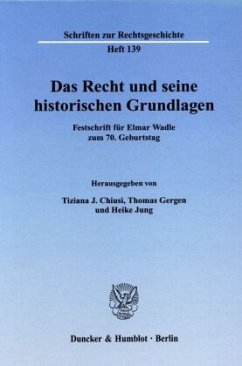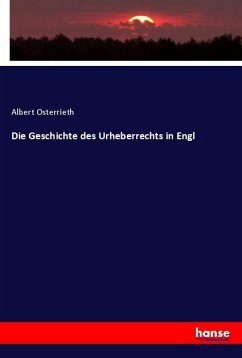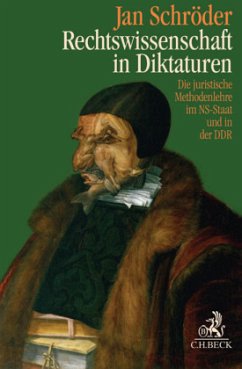streiten um die relativen Anteile - den Verlagshäusern oder Buchhändlern und gewöhnlich nicht den Autoren zugestanden wurde.
Mit solchen Vorrechten konnten die Verleger dann auf Messen unlauteren Wettbewerbern entgegentreten. Dort, wo das nicht ausreichte, behalfen sie sich mit betriebswirtschaftlichen Maßnahmen, um ihr "Verlagseigentum", das sie von den Schriftsteller zumeist beim Erstvertrag erhalten hatten, zu schützen. Sie hielten die Auflage klein, die Bücher teuer, ließen die Werke in Lieferungen erscheinen, um die Käufer zu binden und den Zugriff der Nachdrucker hinauszuzögern. Oder es kam zu schnellen Neubearbeitungen.
Gewitzt durch Erfahrungen mit Verlegern, die ihn übervorteilt hatten, erbat nun auch Goethe sich ein solches Privileg. Daß er es aber bei der Bundesversammlung tat und nicht bei den einzelnen Fürsten der Mitgliedstaaten, ließ den preußischen Generalpostmeister Karl Ferdinand Friedrich von Nagler hoffen, mit diesem prominenten Hebel die allgemeine Diskussion über das geistige Eigentum im Sinne der Autoren voranbringen zu können. Goethe freilich erschwerte das durch forsche Formulierungen in seinem Antrag. Man verwies ihn an die Einzelstaaten zurück und gab diesen die Empfehlung, dem Dichter entgegenzukommen. Im Januar 1826 hatte er dann seine Privilegien beisammen. Bis es zu einem einheitlichen deutschen Urheberrecht kommen sollte, verging noch ein halbes Jahrhundert.
Der Saarbrücker Rechtsgeschichtler Elmar Wadle legt im zweiten Band seiner Aufsätze zur Historie des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts umfassende Studien zum allmählichen Übergang der Privilegienwirtschaft zur modernen Auffassung vor, das geistige Eigentum durch Gesetz zu schützen. Schon der erste Band von "Geistiges Eigentum" bestach durch die Vielfalt des zutage geförderten Materials und seinen Reichtum an bibliographischen Verweisen, der dem Werk Handbuchcharakter verleiht. Neben Überblicksaufsätzen zur Forschungslage und Kommentaren zu historischen Gesetzesentwürfen, die nur den Spezialisten interessieren können, finden sich Beiträge, die auch für Nichtjuristen anregend sind.
So handelt Wadle von den Schwierigkeiten, die man im neunzehnten Jahrhundert zunächst damit hatte, Fotografien als schützenswertes Eigentum ihres Urhebers zu begreifen. Zunächst existierte Fotografie und bildende Kunst friedlich nebeneinander, da in den ersten Fotoausstellungen nur Unikate gezeigt wurden. Als aber um 1850 das Naßkollodiumverfahren die Daguerrotypie zu verdrängen begann, regte sich Widerstand gegen die Gleichstellung der nun leicht reproduzierbaren und andere Kunstwerke leicht reproduzierenden Bilder mit den "echten" gemalten. Neben Erfindungen erfüllten, so wurde argumentiert, nur Kunstwerke als individuelle Hervorbringungen den Begriff des "geistigen Eigentums". Maler und Bildhauer seien die unmittelbaren Urheber ihrer Werke, aber vom Fotografen gelte das nicht. Er führe nur die Möglichkeit des Bildes herbei, nicht das Bild selber.
Während sich der Urheberrechtsschutz für Fotografien allmählich gegen solche mehr ästhetischen als juristischen Einwände durchsetzte, scheiterte der 1855 unternommene interessante Versuch von Zeitungsverlegern, auch ein Eigentumsrecht an telegraphischen Depeschen zu etablieren. Die elektrische Telegraphie wurde nach 1830 zunehmend von großen Blättern genutzt, um Meldungen zu transportieren. Mitunter passierte es dann, daß kleine Zeitungen sich beim ersten Andruck der großen bedienten und, weil ihre kleinere Auflage sich schneller verteilen ließ, die Nachricht oft sogar vor denen, die sie sich als erste beschafft hatten, in Umlauf brachten.
Dies durch ein Eigentumsrecht an Meldungen zu unterbinden leuchtete den Staaten aber nicht ein. Daß die Information durch telegraphische Netze kostspielig sei, habe nichts mit ihrer Form zu tun, die in urheberrechtlichen Fragen allein ausschlaggebend sei. An den Worten "Paris ist ruhig" könne, so der Rechtsgelehrte Julius Jolly, kein vernünftiger Mensch eine Autorschaft beanspruchen. Wadle liefert durch solche Fallstudien nicht nur Bausteine zu einer Rechtsgeschichte, sondern leuchtet den normativen Hintergrund der modernen Massenmedien, des Kunstsystems und einer Konsumwelt aus, in der dem Schutz von Markenzeichen eine immer größere Rolle zugekommen ist. Nur die eigentumsrechtliche Klammer von Wissenschaft und Industrie, das Patentwesen, bleibt von seinen Forschungen unberührt.
Ob es im Bereich von Kunst und Konsum dabei um die Frage geht, inwiefern Klavierbearbeitungen der Ouvertüre zum "Freischütz" eine Art "Nachdruck" sind und vom Verleger der Partitur unterbunden werden können - der letzte Text E. T. A. Hofmanns befaßte sich mit diesem Fall -, oder ob untersucht wird, was das Eigentum an Namen wie "Persil" begründet und warum niemand das Recht haben soll, ein Auto so zu nennen - stets wiederholen sich in den urheberrechtlichen Kontroversen jene Fragen, die auch gegenwärtig an der Technologie des Internet durchexerziert werden. Was ist geistig am geistigen Eigentum? Wer ist zu schützen, der Produzent, der Konsument, das Marktgeschehen oder die Kultur? Und wie soll entschieden werden, wenn das eine nur auf Kosten des anderen geht?
Eine Antwort auf diese Frage, die sich das neunzehnte Jahrhundert mühsam erarbeitete, hieß Temporalisierung. In seiner "Rede auf Schiller", die Jacob Grimm 1859 in der Berliner Akademie der Wissenschaften hielt, griff der große Philologe die Konzentration der Eigentumsrechte beim Verleger scharf an. Cotta habe zum Schiller-Fest nicht einmal den Abdruck der "Glocke" zugelassen. "Das Eigenthum der Welt" am großen Schriftsteller aber sei "das höhere", "und größere Ansprüche fließen daraus her als sogar Erben und Nachkommen besitzen". Zu Lebzeiten solle der Autor die Frucht neuer Ausgaben mitgenießen, nach seinem Tod eine Zeitlang Erben und Verleger, dann aber nur noch "die Welt". Wenn man nicht allen Interessen zugleich gerecht werden kann, dann muß man es eben nacheinander und auf Zeit tun.
JÜRGEN KAUBE
Elmar Wadle: "Geistiges Eigentum". Bausteine zur Rechtsgeschichte. Band 1 und 2. C. H. Beck Verlag, München 2003. 601 und 421 S., geb., 94,- und 79,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
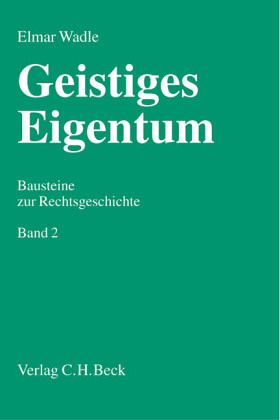





 Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung