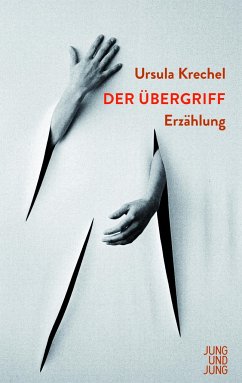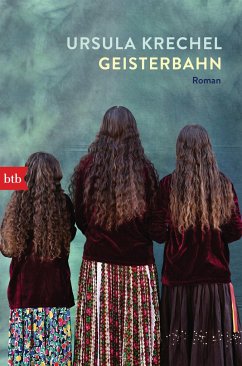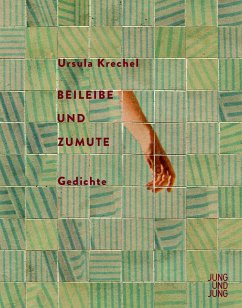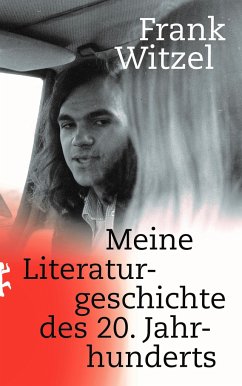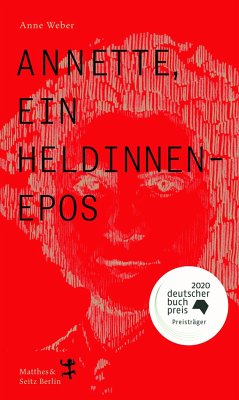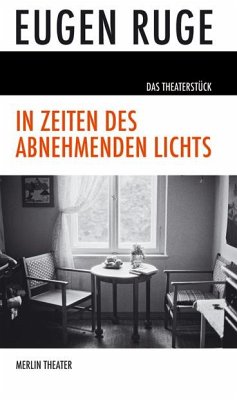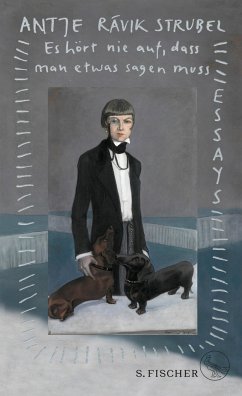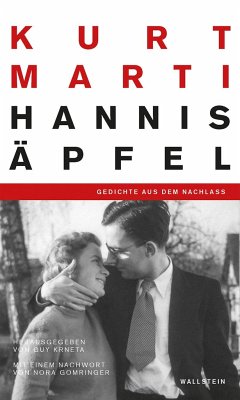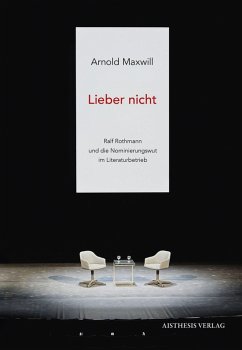Schicksal der alten Dame bringt sie zur Frage, dann zur Feststellung: "Warum erzähle ich das? Erstens: Kein Gegenstand ist zu gering für einen Essay." Denn ein Essay ist "Denkbild", ist "Ort der Versuchung, Ausschweifung und Engführung zugleich". Ein "zweitens" scheint, vorerst, nicht gegeben. Vielleicht handelt es sich um eine Ankündigung für all das, was auf den 450 Seiten von Krechels neuem Buch, das sie schlicht "Essays" untertitelt, folgen wird. Zuvor kommt die Schreiberin zu einem ihr vertrauten Metier zurück: "Das Gedicht ist unmittelbar mit der Erfahrung von Schnelligkeit verbunden. Auf einen Blick ist die Gestalt des Gedichts zu erfassen, seine Länge, sein Zeilenfall, alles sagt: Dies ist eine spezifische Sprechweise."
Dabei bleibt es nicht, es kann auch anders sein, so wie ihre eigenen späteren Gedichte, "eher langfristige Operationen in der Entwicklung von Beschleunigung". So wie die geriatrische Situation, im Wechsel zwischen versuchter Mobilisierung und nahendem Ende. Krechel zitiert Paul Virilio, den Philosophen des Medienkriegs, der schrieb: "Mobilisierung, In Gang setzen der Körper, Reise, Exodus, Deportation, Verschleppung - stets gegenwärtig im Abendland, im Frieden wie im Krieg." Wir sind ihrer Denkbewegung gefolgt, sie reicht in die unmittelbare Gegenwart.
Das Schweifen, das Weitschweifige, die Schleifen machen den Reiz jedes einzelnen dieser 25 Texte aus, den Gewinn an Erkenntnis für den Leser, die Leserin (Krechel selbst beharrt auf der Nennung beider Genera in ihrem Schreiben). Es sind, unter der Hand und manchmal offen, Reflexionen auf ihre eigene Geschichte, seit dem frühen aufsässigen Feminismus und der Einübung in scharfe Kritikfähigkeit, die ihr keinerlei Kompromisse und Unterwürfigkeit gegenüber herrschenden Diskursen gestatten. Es ist eine schöne Anstrengung, kein Gedanke wird dabei schleifen gelassen.
Der zweite Essay, "Die Gangart des Abenteurers", nimmt die Fährte auf: "Erzählen heißt: Zeit vernichten"; denn "Lesezeit ist eine spezifisch verlebte Lebenszeit". Genau an diese Form der Zeitvernichtung macht sich Ursula Krechel - mit Bedacht, lässt sich sagen und ihr dafür dankbar sein. Sie entfaltet nicht nur nachgerade enzyklopädisches Wissen, sondern führt vor, was sich mit einem solchen Vorrat anstellen lässt - die Fähigkeit vorausgesetzt, ihn in eigene Schöpfungskraft umzumünzen. Sie folgt den Spuren Giacomo Casanovas, lässt Friedrich den Großen ihn beim Spaziergang in einem Park "einen sehr schönen Mann" nennen und zieht ihre Konsequenzen aus Casanovas Bekenntnis über die Frauen - "Je les adorais m'adorant" - um Jacques Lacans doppelbödige Theorie des Begehrens leichthändig zu streifen.
"Im Spiegel der Freundschaft" ist es dann, in der Abteilung "Sehen", der Blick des Nazareners Friedrich Overbeck, der ein Freundschaftsbildnis des genauso jungen Malerkollegen Johann Carl Eggers schafft: "Oder imaginiert er malend den Blick des Freundes, der auf ihn gerichtet ist?" Ursula Krechel ist eine wahre Verführerin. Unter "Sehen" passt auch "Aufdringliche Nähe", in die sie sich selbst als junge Frau begab, um 1972 ein Interview mit Rolf-Dieter Brinkmann zu erreichen. Es ist das Protokoll eines Encounters der schwierigen Art: "Eine Lehre im Verfehlen. Wie der Abend geendet hat, weiß ich nicht mehr." Brinkmanns Gedichte sind jetzt auf Wiedervorlage.
Bei "Träumen" begegnen wir den vier Geschwistern Brontë in ihrem düsteren Pfarrhaus, wo sie sich dem gefährlichen "Tagtraum der begabten Kinder" hingeben. Überhaupt setzt Krechel sich in den Essays immer wieder mit dem Verhältnis von Traum und Literarizität auseinander, mit Sigmund Freud, nicht nur seiner "Traumdeutung", und tritt entschieden jeder wohlfeilen Hermeneutik entgegen, zugunsten einer Dekonstruktion seines Denkens. Es ist nur konsequent, dass sich das vom ersten Text her noch ausstehende "zweitens" dort findet, wo es um "Die Öffnung einer Grube: vom Träumen in Diktaturen" geht; denn auch das Träumen ist politisch. Ein zu Literatur verdichteter Traum Heiner Müllers, sechs Jahre nach dem Fall der Mauer und kurz vor seinem Tod, lässt sie an "eine Diktatur der Zwangsläufigkeit" denken, der "Tod ist eine Gewissheit, lebenslänglich todesängstlich zu betrachten". Er führt sie zurück ans Sterbebett der alten Frau, die ihr oft sagte, dass sie doch ein Kind habe. Dieses Kind war inzwischen ein Mann von sechzig Jahren, und "ich wusste nichts Besseres, als ihr zu sagen: Ich sorge doch für das Kind. Diese Aussicht befriedigte uns beide. John Donne: Death, thou shalt die." Kein Anflug von Sentimentalität. Eher zu begreifen, wie "Unter Bäumen" ihr eigenes Gedicht "Faksimile eines Naturgefühls" beginnt: "So könnte es sein: / Unter Bäumen umherschweifen / ohne etwas zu erkennen."
Ursula Krechel macht die Wahrnehmung liquid. Nichts steht geschrieben, das Erkennen ist ein Abenteuer, dem sie sich hingibt, wider die Erstarrung des Denkens, der Erinnerung, des Handelns. So belesen wie sie sind wenige, aber noch wenigeren gelingt es so mitreißend, die anderen auf unbekannte Pfade zu locken. Folgen wir ihr doch auf ihren Haupt- und Nebenwegen. ROSE-MARIA GROPP
Ursula Krechel:
"Gehen. Träumen. Sehen. Unter Bäumen." Essays.
Verlag Jung und Jung, Salzburg 2022. 480 S., geb., 30,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
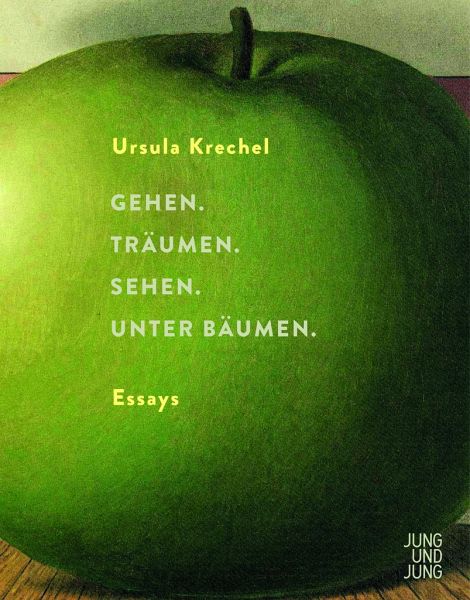




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.03.2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.03.2022