Geschichte. Darin wird das Erzählte erst einmal als (bloß) erzählt vorgeführt. Danach aber lässt es die Leinen der Leidenschaften los. Wie Pirandellos sechs Personen, die einen Autor suchen, naht sich der "Frau mit den kurzen Haaren" (wie Maraini selbst) die schwankende Gestalt der Zaira und bittet um Aufnahme in eine Geschichte.
Deren Enkelin Colomba, Anfang zwanzig, Postangestellte, war plötzlich, mitten im Frühstück, spurlos im Wald von Ermellina verschwunden. Seitdem ist ein Jahr vergangen. Alle haben sie aufgegeben. Gegen jeden Anschein hatte Zaira eine geradezu fundamentalistische Suche begonnen. Doch wie sollte ausgerechnet die Schriftstellerin ihr helfen? Gewiss, sie hat am Ort ein Ferien- und Schreibhaus. Realität und Roman scheinen voneinander zu wissen. Mehr noch: man könnte - sollte gar? - auf den Gedanken kommen, Zaira verkörpere nur ein Drama, das die Phantasie der Erzählerin in den Wald von Ermellina (vor ihrer Tür) hineinsieht und gleichsam Sprache werden lässt. Schon zur Zeit der Römer war der Wald Schauplatz eines verheerenden Gemetzels, später ein Konzentrationslager. So nimmt die Suche Zairas mythische Züge an, sie handelt wie ein weiblicher Lanzelot. Die Erzählerin beutet die Ausfahrt ihrer Heldin jedoch vor allem aus, um darin hundert Jahre Familienschicksal zu spiegeln.
Warum diese üppige Digression? Man soll wohl ahnen: Leben heißt, sich in einem Wald voller Trennungen, Armut, unsinniger Tode, Auswanderungen, Verwaisungen, verratener Liebe, Partnertausch zu verlieren. Doch immer wieder stehen Figuren auf, meistens Frauen wie Zaira (und deren Erzählerin!), die den Bann zu brechen versuchen. Zaira darf Colomba schließlich, im Wald, finden und sie dem bösen Zauber von Drogen und Prostitution entreißen.
Dieses Happy End will jedoch nicht nur mit 436 Seiten Lektüre verdient sein. Bereits nach wenigen Mosaiksteinen verdoppelt sich die Zwiesprache von Zaira und Erzählerin. Hinter ihnen taucht eine (junge) Mutter auf, die ihrer Tochter auffällige Gutenachtgeschichten erzählt, zuerst von ihrem Mann, dem Gebirgsjäger. In dessen Liedern kehrt allerdings einer wieder, in dem die Erzählerin den Großvater von Zaira erkennt. Von da an wird, was "unten" vorfällt, als Oberstimme von Mutter und Tochter, in Märchen, Mythen, Sagen und Historien fortgesponnen. Doch damit nicht genug. Unaufhaltsam wandern die Geschichten von Zaira allmählich auch dort ein. Am Ende geht schließlich alles ununterscheidbar ineinander auf; die Mutter erzählt der Tochter die Geschichte, die Zaira der Erzählerin erzählt hat. Diese sieht sich genötigt, einen Dialog mit der Erzählung zu führen, die sich ihrer bemächtigt hat. Der Leser hat also zu tun. Wie im Film durchdringen sich Szenen und Ebenen und lassen Verbindungen ahnen, die aber selbst am Ende nicht völlig aufgehen. Zum Glück für das lesende Publikum gibt es aber Zaira: Für uns bespricht und durchkämmt sie das narrative Dickicht: Was wir lesen, ist nur ein Abschlag von dem, was sie eigentlich hatte schreiben wollen, aber nicht konnte: von einem Jungen, der in Auschwitz verschwunden ist. Wir stehen damit zumindest moralisch auf festem Grund; das Übel in der Welt muss ans grelle Licht des Bestsellers gebracht werden.
"Fast wie ein Verhängnis" wiederholt sich alles von Generation zu Generation. Und dann? Die Antwort kommt aus Kindermund: "Erzähl mir eine Geschichte", bittet die Tochter ihre junge Mutter; "nur Geschichten können die Zeit anhalten." Und so erzählt auch Maraini eine nach und über der anderen und gibt dem Leser, was des Lesers sein soll: Verständnis für alles. Für den schönen Vater Colombas, der trotz zahlreicher Liebschaften einsam ist; für den Urgroßvater Pietrucc', der zu dumm war und an den Kommunismus geglaubt hatte; für die jungen Musliminnen, die sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft jagen; selbst für die Vogelgrippe. Wer sich in den Fäden der Narration verfängt, kann sich immer sicher fühlen: Die Erzählerin weiß, wie es besser wäre.
Dieser Schulterschluss der Wohlmeinenden - ist das der Preis, der für Erfolg entrichtet werden muss? Dann wäre political correctness ein Bedürfnis der Leserschaft? Aber andererseits doch nur wieder in erfundenen Geschichten vom Leben, die allemal lügen dürfen?
WINFRIED WEHLE
Dacia Maraini: "Gefrorene Träume". Roman. Aus dem Italienischen übersetzt von Eva-Maria Wagner. Piper Verlag, München 2006. 436 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
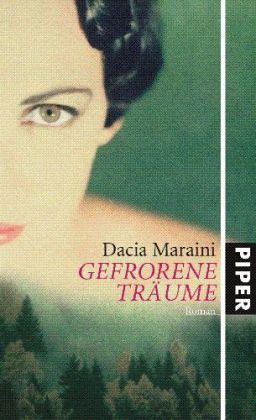




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.04.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.04.2007