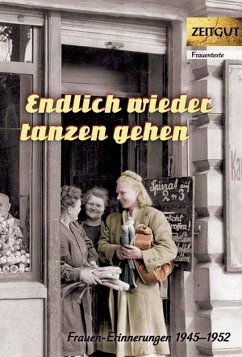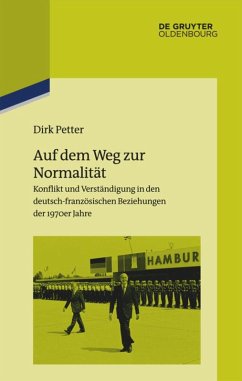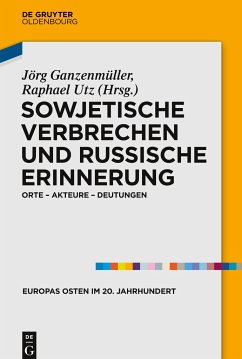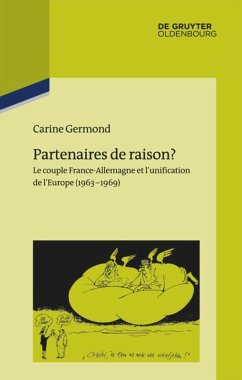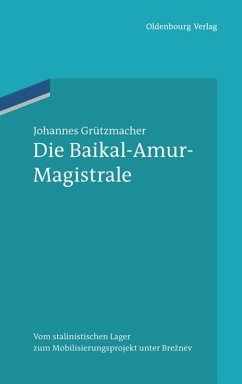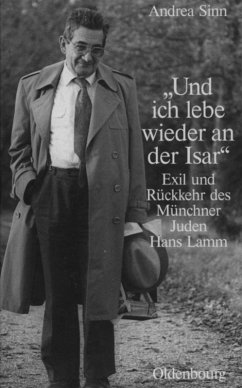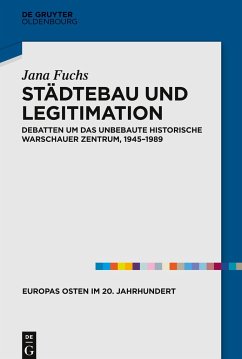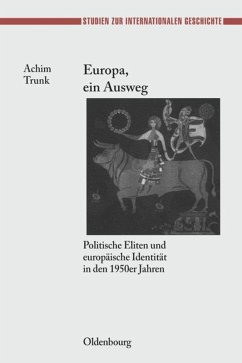sollte: Deutschland und die Deutschen. Bereits 1932 erfolgte die Berufung zum Professor für Europäische Geschichte. 1943 wurde der Deutschland-Kenner vom Nachrichtendienst des amerikanischen Kriegsministeriums verpflichtet und mit Studien zur Feindaufklärung und Besatzungsplanung in Mitteleuropa betraut. Zweieinhalb Jahre später, im Februar 1946, kam er beim OMGUS unter, dem Office of Military Government for Germany (US). Für knapp fünf Monate stand er nun in Diensten der amerikanischen Militärregierung in Deutschland, die ihn zum Berater des amerikanischen Stadtkommandanten von Berlin berief.
In dieser Zeit, von März bis August 1946, entstanden Aufzeichnungen, die seine Erlebnisse für eine spätere Auswertung konservieren sollten. Zumeist in Briefform verfasst und an seine Ehefrau adressiert, beschrieb Johnson seine Eindrücke und Empfindungen, in denen sich Persönliches und Politisches vermischen. Herausgekommen ist eine mehr oder minder selektive Schau auf "Fünf Monate in Berlin", die nunmehr in einem mit äußerster Sorgfalt editierten und mit größter Akribie kommentierten Band nachzulesen ist. Tatsächlich lassen die Herausgeber keinen Leserwunsch unerfüllt; sogar eine 50-seitige Zusammenstellung von Hintergrundinformationen, Überlieferungsgeschichte und Biographie findet sich in dem Buch, ergänzt von einem 60-seitigen Anhang mit Bildern.
Für den Dokumenten-Teil selbst müssen die Herausgeber gewissermaßen Abstriche machen: Wie sie einräumen, sei bereits "weitgehend bekannt", was in den 83 Dokumenten über die politische Entwicklung Berlins berichtet wird. Tatsächlich bezieht der Band seinen Erkenntnisgewinn vor allem aus Johnsons subjektiver Dokumentation von Stimmungen und Urteilen. So liest man etwa - mit einiger Überraschung - über Walter Ulbricht, dass der "Kommunistenführer", der "verzweifelt wie Lenin auszusehen versucht", nicht nur ein "skrupelloser", sondern gar ein "cleverer Demagoge" sei. Demgegenüber machte "ein Dr. Schumacher" offenbar weniger Eindruck auf Johnson - umso mehr wollte er dessen Sozialdemokraten unterstützen, weil diese Leute für das westliche Demokratiemodell einstünden.
An solchen Stellen wird Interessantes zu Relevantem, jedenfalls verdient Beachtung, was Johnson an politischen Binnenansichten überliefert, etwa zur Zwangsvereinigung von KPD und SPD, zur ersten Kommunalwahl im Nachkriegs-Berlin oder der Ausarbeitung einer Berliner Verfassung, an der er direkt beteiligt war. Auch und gerade jene Kritik ist von Bedeutung, in der er eine von allerlei Ignoranz geprägte Besatzungspolitik beklagt oder eine grundsätzliche Perspektivlosigkeit der amerikanischen Neutralitätsstrategie beanstandet. Die Vereinigten Staaten müssten jedenfalls "einen noch besseren Job in Deutschland" machen, um einen "positiven Beitrag zur Befriedung Europas und der Welt" zu leisten, urteilt Johnson - der allerdings einen umfassenden, systematischen Entwurf seines Konzeptes schuldig bleibt.
Gewiss, Tagebuchbriefe bieten sich kaum als Instrument für eine schärfere Analyse von Strukturen, Prozessen und Personen an. Doch solche Ausführungen hätte man gern gelesen von einem Historiker, Deutschland-Experten und Geheimdienstanalysten, der sich dem explizit benannten Ziel verbunden fühlte: "winning the peace".
LARS LÜDICKE
Werner Breunig/Jürgen Wetzel (Herausgeber): Fünf Monate in Berlin. Briefe von Edgar N. Johnson aus dem Jahre 1946. Verlag De Gruyter Oldenbourg, München 2014. 458 S., 39,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
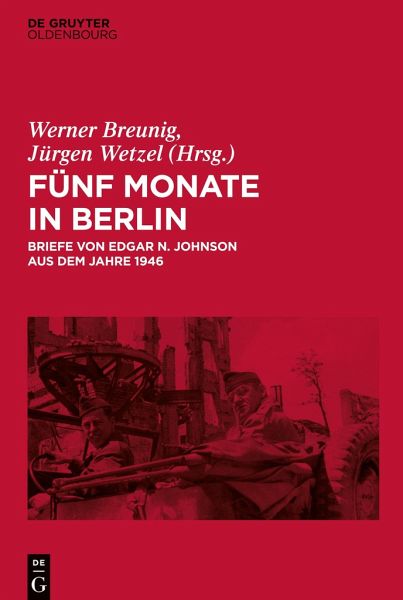




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.05.2015
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.05.2015