der Essayist, Reiseschriftsteller und kulturpolitische Polemiker sein Leben konsequent als geheimnisvollen Abenteuerroman, immer auf der Flucht vor den eigenen Masken und den Bedrohungen durch reale oder eingebildete Gegner.
Ein Jahr nach der umfangreichen Sieburg-Biographie von Klaus Deinet (F.A.Z. vom 28. Mai 2014) hat der Literaturwissenschaftler und ehemalige Bremer Rundfunkredakteur Harro Zimmermann nun noch einmal eine ausführliche Lebensbeschreibung des Geistesaristokraten und Causeurs vorgelegt. Die Bücher von Deinet und Zimmermann gehen im Prinzip vom gleichen archivalischen Arsenal aus - so dem Tagebuch 1944/45, das von der irgendwie sadomasochistischen Beziehung Sieburgs zu seiner dritten Ehefrau Dorothee Gräfin Pückler kündet, und dem Nachlass des Publizisten im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Deinets Arbeit hat einen stärker auf Frankreich bezogenen Schwerpunkt, Zimmermann pointiert mehr und, durchaus erhellend, die Kontakte Sieburgs zum "Tat"-Kreis um Hans Zehrer, der mit General Schleicher die nationalsozialistische Bewegung 1932 in eine "Querfront" mit Reichswehr, Teilen der Sozialdemokratie und Gewerkschaften emporzuheben trachtete. Zudem möchte Zimmermann den wankelmütigen Helden seiner Biographie als einen der intellektuellen Mitbegründer der Bundesrepublik gewürdigt wissen, eben nicht nur als reaktionären Antipoden in den mitunter infantilen Auseinandersetzungen um die Geltung der "Gruppe 47" um Hans Werner Richter. Diese kam dem selbsternannten freien Radikalen Sieburg bald als Pseudo-Avantgarde und "völlig uniformes" Literatur-Politbüro vor.
Dabei hatte Sieburg selbst als junger Student in Heidelberg die Gruppenwärme des "geheimen Deutschland" gesucht, also des Kreises um Stefan George, Friedrich Gundolf und den "Jüngling Maximin". Allerdings hatte man den gerade Zwanzigjährigen als vermuteten Schnorrer und Hochstapler aus diesem Zirkel unsanft wieder ausgestoßen. Sieburgs intellektuelle Formung durch Hölderlin, Nietzsche, Hofmannsthal, Rilke und George, auch die expressionistische Verarbeitung der Fronterlebnisse im Ersten Weltkrieg ist für eine bestimmte Generation von Deutschromantikern nicht ungewöhnlich. Sieburgs große Karriere beginnt dann 1926 als Pariser Korrespondent für die "Frankfurter Zeitung" (FZ), wo er seinen typischen Stil aus feuilletonistischen Detailbeobachtungen, völkerpsychologischen Stereotypen und politischen Versöhnungsentwürfen formt. Der Kern seines Sinnens und Trachtens blieb aber stets die vertrackte Sehnsucht nach der metapolitischen "Deutschwerdung" Europas. Nach 1945 war es damit natürlich auch für Sieburg vorbei.
Harro Zimmermanns durchweg elegant und im Sinne seines Protagonisten einleuchtend argumentierte Biographie macht aber vor allem - und vielleicht unfreiwillig - eines deutlich: substantiell bleibt von Sieburgs kulturpolitischer Publizistik wenig Brauchbares übrig. Schon dessen linke Essays für die "Weltbühne" vom Anfang der zwanziger Jahre sind konfus, mal verteidigt er George Grosz gegen Muckertum und Zensurbehörden, mal warnt er vor der Bubikopf-Mode als Zeichen drohender Entweiblichung. Seinen Bestseller "Gott in Frankreich?" (1929) haben schon alarmierte französische Zeitgenossen als mäßig getarnten deutschnationalen Umarmungsversuch gelesen. Ein noch ärgeres Durcheinander stiftete Sieburg mit seiner ebenso eiligen wie schwefligen Monographie "Es werde Deutschland" (1933) im Frankfurter Societäts-Verlag, die von Verleger Heinrich Simon gegen erhebliche Widerstände im Haus der "Frankfurter Zeitung" durchgedrückt wurde; der neue "Star" Sieburg hatte mit Abwanderung in neukonservative Gefilde gedroht.
Nach 1933 fanden die zahlreichen deutschen Emigranten in Paris das mondän-herablassende Auftreten des "FZ"Korrespondenten, während im Hitlerstaat gemordet und gefoltert wurde, nicht mehr so lustig. Zimmermann nennt das nobel die "Sieburgsche Mimikry an die außenpolitische Repräsentanz des Dritten Reiches". 1939 wird der Ex-Journalist Botschaftsrat für das Ribbentropsche Außenamt in Brüssel und Paris; es stehe fest, so Zimmermann, "dass er seit Sommer 1940 für alle sichtbar zur Elite-Formation des deutschen Besatzungspersonals gehört". Der Rest, etwa Sieburgs antisemitische Ausfälle gegen Heinrich Heine 1942/43 in Karl Eptings Zeitschrift "Deutschland-Frankreich", ist bekannt. Nüchtern hatte der einstige Sieburg-Freund Kurt Tucholsky schon früher geschrieben: "Ein Talent, doch kein Charakter. Die Franzosen glauben es ihm nicht mehr. Er soll Botschafter werden. Und uns in Ruhe lassen".
Einmal verwechselt Zimmermann in seinem Buch den "FZ"-Redakteur Bernard von Brentano mit dessen Bruder Heinrich, dem späteren deutschen Außenminister unter Adenauer. Dieser an sich unwichtige Fauxpas weist aber in eine interessante Richtung: die Karrieremuster, Freundschaften und Mentalitäten in der "Frankfurter Zeitung" der zwanziger und dreißiger Jahre wären einmal eine Studie über strategische und intellektuelle Publizistik in Deutschland wert. Und dass ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, das auf sein Ansehen bedacht wäre, aus der farbigen Lebensgeschichte Friedrich Sieburgs eine spannende Spielserie machen könnte - als Weltreisender kam er bis Timbuktu und auf die Faröer -, steht außer Frage. Dafür könnte Zimmermanns Biographie eine gute Grundlage liefern.
Harro Zimmermann: "Friedrich Sieburg - Ästhet und Provokateur". Eine Biographie.
Wallstein Verlag, Göttingen 2015. 488 S., geb., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
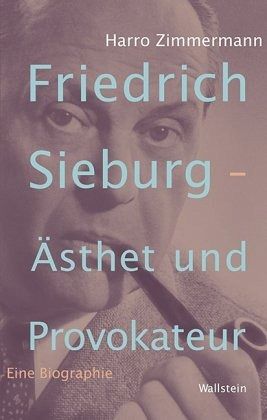




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.10.2015
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.10.2015