von Lautréamonts "Gesängen des Maldoror", eines der bösesten Bücher der Weltliteratur, diabolische Gegenschöpfung und sprachgewaltige Urzeugung der modernen Literatur, die den Zusammenhang des Schönen und des Guten für immer zerriß.
Tobias O. Meißner ist ein ferner Nachfahre jenes Autors und seines blasphemischen Versuchs, mit den Mitteln der Kunst Gott und die Welt zu negieren. Doch im zwanzigsten Jahrhundert hat die Ästhetik des Schreckens nicht nur ihre Überbietung in der Wirklichkeit gefunden, sie ist zugleich zum unerschöpflichen Stoff der Populärkultur geworden, wurde in Groschenheftchen, Horrorfilmen, Comics und Rocksongs trivialisiert und unendlich verfeinert. Meißner, Jahrgang 1967, gehört einer Generation an, die mit all dem ganz selbstverständlich aufgewachsen ist. Sein Held Hiob Montag, Abkömmling einer langen literarisch-dämonologischen Ahnenreihe, weiß ebenfalls, daß er nicht der erste und auch nicht der letzte ist, der im Kampf zwischen Gut und Böse in vorderster Front steht. Seine Geschichte ist angesiedelt in einer naturalistisch-düsteren Welt, die vom Schattenreich der Popkultur überlagert ist.
Hiob lebt als Künstler in Berlin, seine Bilder, in denen Kritiker nur Abstraktion, Eingeweihte jedoch sadistische Schreckensszenen erkennen, stellt er in einer kleinen Galerie aus. Doch sein Teufelspakt dient nicht wie der von Manns Leverkühn der Befeuerung künstlerischer Innovationskraft, sondern ist ein Unterfangen von endzeitlicher Dimension. Hiob hat sich selbst zur Spielfigur in einer Partie gemacht, deren Regeln die höchste Macht des Bösen bestimmt, hier NuNdUuN genannt. Hiob muß mit bescheidenen übersinnlichen Kräften immer schwierigere Aufgaben lösen und teuflische Gegner vernichten, wofür er nach einem obskuren Punktesystem belohnt wird.
Das erste "Prognosticon" - so heißen die leichten Gegner - spürt Hiob in der kolumbianischen Hafenstadt Barranquilla während des Karnevals auf, wo in einer psychiatrischen Anstalt massenhaft Menschen auf grausamste Weise ermordet werden. Mit Hilfe einer aidskranken deutschen Studentin, die das Bacchanal nutzen will, um möglichst viele Männer zu infizieren, dringt Hiob in die Todesfabrik ein und befreit die vegetierenden Insassen. Die folgenden Aufgaben führen Hiob in die Death Row eines amerikanischen Hochsicherheitsgefängnisses, wo er sich auf dem elektrischen Stuhl grillen lassen muß, um eine bei der Exekution ins Stromnetz eingedrungene Mörderseele einzufangen, und ins Bayern der zwanziger Jahre, wo der Geist eines gefallenen Soldaten die Familie seiner Verlobten mit der Axt auslöscht. Schließlich muß Hiob noch Jagd auf ein Rudel selbsternannter Vampire im Berlin der Neunziger machen, um sie sachgerecht mit Holzpflock, Knoblauch und Sonnenlicht aus ihrem abartigen Verkehr zu ziehen.
Die Grausamkeiten einzeln aufzuzählen wäre müßig: Da werden Kinder geschlachtet und Mädchen geschändet, Menschen gequält und lebendigen Leibes verbrannt, Knochen freigelegt, Geschlechtsteile abgeschnitten, Blutorgien gefeiert - schließlich wird als höllischer Höhepunkt die Hirnmasse eines lebenden Säuglings ausgeschlürft (auch das eine Lautréamont-Anspielung). Die detaillierten Schilderungen sexueller Perversionen und grausamer Rituale, die an Sade, aber auch an Burroughs oder Easton Ellis erinnern, lassen jede Bewährung Hiobs zugleich zur Prüfung für empfindliche Leser werden, die als die eigentlichen Mitspieler NuNdUuNs erscheinen.
Doch heutzutage zieht selbst der Teufel dem Schachbrett die Playstation vor. Die Handlung folgt dem Prinzip eines actiontaumelnden Computerspiels: Monster getötet, Mission erfüllt, nächster Level erreicht. Den Highscore, so erfährt Hiob einmal beiläufig von seinem Großvater, einem abgedankten Magier im Altenpflegeheim, hält mit siebzehn Punkten ein chinesisches Bauernmädchen aus dem siebzehnten Jahrhundert. Zum Sieg über NuNdUuN braucht man 78 Punkte. Am Ende dieses Buchs, das also noch lange nicht das Ende des Spiels ist, hat Hiob sieben Punkte ergattert und dafür bereits so viele Unschuldige auf dem Gewissen, daß man es nicht gerade einen Segen für die Menschheit nennen wollte, wenn er einmal anstelle des sadistischen NuNdUuN das Zepter des Höllenreichs schwingen wird.
Überhaupt ist die ebenfalls aus allen Winkeln der Welt herbeizitierte Dämonologie nicht der Rede oder gar gedanklicher Auseinandersetzung wert. Auch daß der hochsensible Künstler Hiob mit solchem Einsatz spielt, rechnet man statt einer stimmigen Psychologie lieber den Gesetzen des Genres zu, die nun mal den Machtkampf zwischen Gut und Böse fordern. Meißners Stärke liegt nicht in der Reflexion, sondern in der kaum gefilterten (oder redigierten) Gewalt seiner Phantasien, die der wüsten Bilderwelt unseres kulturell Unbewußten Sprache verleihen: "Ihr Schädel öffnete sich schreiend und spie all ihr Erinnern nach draußen. Ihre Stimmbänder versuchten noch, Antons Namen zu formen, als ihr Kopf schon mehrere Schritt entfernt lag." Nicht immer geht das Kalkül auf, den Schock solcher Sätze durch eine flapsige Dialogregie in Hollywood-Manier kontrastierend zu verstärken. Gleiches gilt für die Experimente mit Satz und Typographie, ein wahres Inferno des Layout-Programms, das wie die lässigen Westernheldsprüche Hiobs oft nur albern wirkt. Dagegen brennen sich die Exzesse des Verbotenen mit grellen sprachlichen Bildern für Schmerz und Tod ins Gedächtnis. Kein Zufall, daß auch die "Gesänge des Maldoror" eine Theorie der "kühnen Metapher" enthalten. Denn Gewaltdarstellung ist in der Kunst stets Motor formaler Innovation gewesen.
Mit seinem großartigen, ähnlich sinistren Debütroman "Starfish Rules" von 1997 hat Meißner bereits bewiesen, daß er nichtlineare Erzählformen und popkulturelles Treibgut zu einer neuartigen Synthese verschmelzen kann. Danach folgten schwächere Bücher wie der Rockroman "HalbEngel" (1999) oder "Todestag" (2000). "Hiobs Spiel" nun soll, wie der Klappentext aufklärt, ein auf fünfzig Jahre angelegtes Projekt sein, von dem jetzt das erste Buch vorliegt. Doch schon damit etabliert sich Meißner als eine wichtige Stimme der jüngeren deutschen Literatur, auch wenn diese Stimme sich bisher überwiegend schreiend Gehör verschafft. Jenseits aller Popdebatten will Meißner Hoch- und Subkultur an jenem Punkt wieder zusammenführen, von dem einst die Moderne ihren Ausgang nahm. Hier treffen sich der Terminator und der Türhüter in der Leichenhalle, und dazu spielt Musik, die klingt, als würden "Slipknot" den Soundtrack zu den "120 Tagen von Sodom" einspielen oder Marilyn Manson Mahlers "Kindertotenlieder" covern. Meißners Hiob ist ein selbstironischer Faust unter den Bedingungen technischer Reproduzierbarkeit, ein postmoderner Magier im Zeitalter von Action Man.
Man mag diese Art Literatur als Fall für den Jugendschutz zu den Akten legen oder dem Autor seine läppischen Effekte, Kalauer und Fehlgriffe vorhalten - der Versuch, Horror, Trash und Kitsch für die Literatur zurückzuerobern, wird nicht dadurch entwertet, daß beim "Zweiten Buch" die Erzählkonstruktion ambitionierter ausfallen könnte. Gerade blanke Klingen brauchen Feinschliff. Statt der Warnung vor "explicit lyrics" sollte auf dem Schutzumschlag dann dieses Lautréamont-Zitat stehen: "Es ist nicht gut, daß jedermann die folgenden Seiten lese; nur einzelne werden diese bittere Frucht gefahrlos genießen."
Tobias O. Meißner: "Hiobs Spiel". Erstes Buch - Frauenmörder. Verlag Eichborn Berlin, Berlin 2002. 368 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
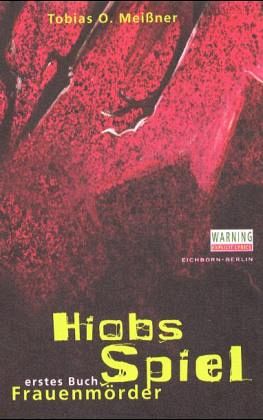





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.10.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.10.2002