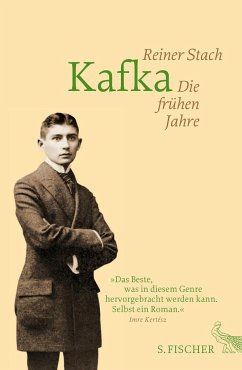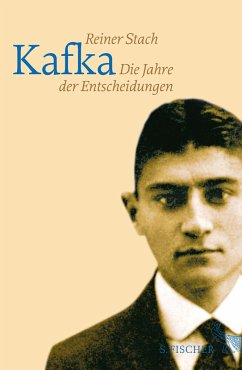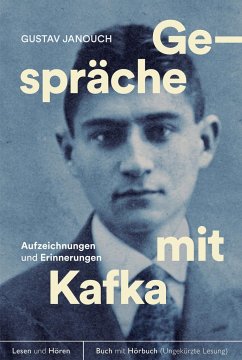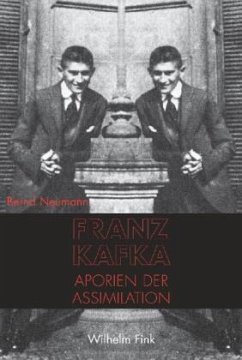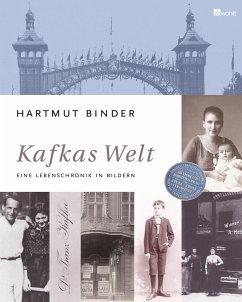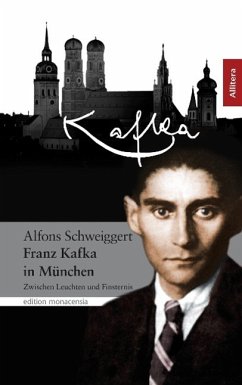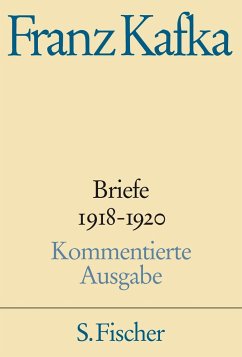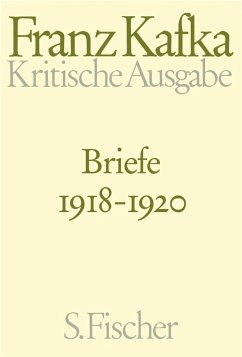Nicht lieferbar

Franz Kafka
Gesellschaftskrieger. Eine Biographie
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Vor uns entsteht ein völlig neuer Kafka: ein Gesellschaftskrieger, der unablässig um seine Beheimatung im Assimilationsprozeß ringt, der weiterhin in den ersten Jahren als überzeugter Beamter seiner Prager Behörde an der Verbesserung der Donaumonarchie intensiv mitgearbeitet hat, was in sämtlichen bisherigen Biografien nicht ins rechte Licht gestellt wurde. Es erscheint ein Liebender, dessen zahlreiche Affären hier zum ersten Mal zusammengestellt und überhaupt erst um die wichtigsten ergänzt werden, Liebesverhältnisse, die eben nicht ohne weiteres mit den Namen Felice und Milena ersc...
Vor uns entsteht ein völlig neuer Kafka: ein Gesellschaftskrieger, der unablässig um seine Beheimatung im Assimilationsprozeß ringt, der weiterhin in den ersten Jahren als überzeugter Beamter seiner Prager Behörde an der Verbesserung der Donaumonarchie intensiv mitgearbeitet hat, was in sämtlichen bisherigen Biografien nicht ins rechte Licht gestellt wurde. Es erscheint ein Liebender, dessen zahlreiche Affären hier zum ersten Mal zusammengestellt und überhaupt erst um die wichtigsten ergänzt werden, Liebesverhältnisse, die eben nicht ohne weiteres mit den Namen Felice und Milena erschöpfend benannt sind. Bernd Neumanns umfassende Biografie berücksichtigt den letzten Stand der Kafka-Forschung ebenso wie die neuesten Erkenntnisse über Kafkas Leben und Sterben. Sie macht das Leben dieses Jahrhundertgenies anschaulich durch die Einblendung zahlreicher zeitgenössischer Stimmen, die die Umstände von Kafkas Existenz beleuchten und vor dem geistigen Auge des Lesers sinnlich konturieren.