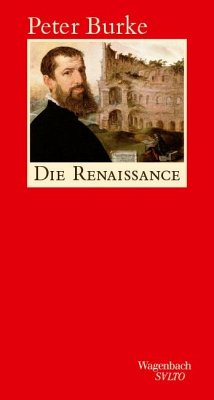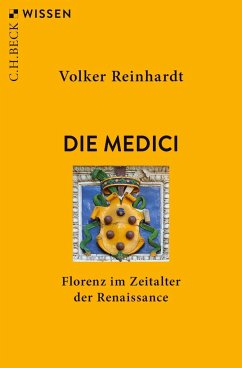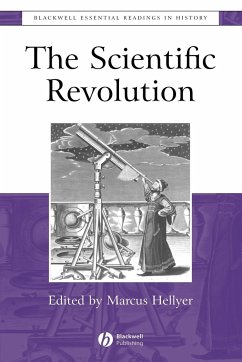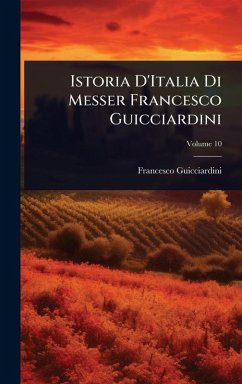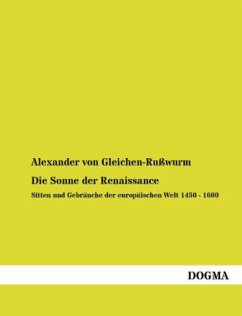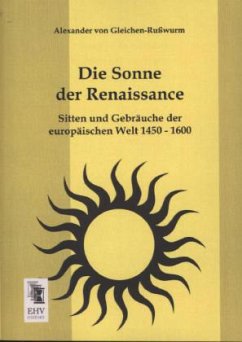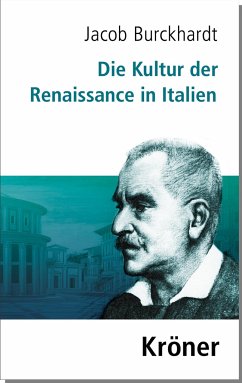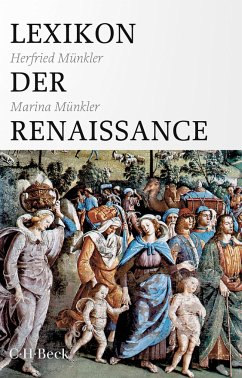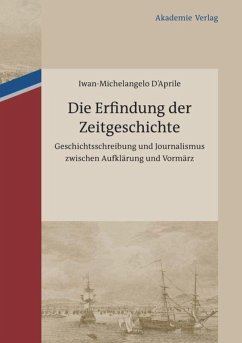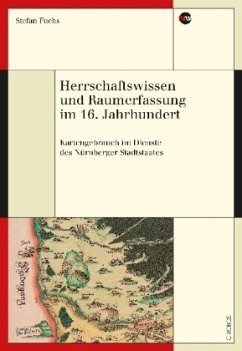Francesco Guicciardini (1483-1540)
Die Entdeckung des Widerspruchs
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
24,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Volker Reinhardt arbeitet in seiner Darstellung von Leben und Werk des florentinischen Politikers Francesco Guicciardini (1483-1540) die Zeitgebundenheit ebenso wie die Aktualität einer faszinierenden Ideenwelt am Beginn der Moderne heraus.Francesco Guicciardini (1483-1540), florentinischer Patrizier, Provinzgouverneur im Kirchenstaat und von 1523 bis 1527 einer der einflußreichsten Berater Papst Clemens' VII. Medici, ist einer der herausragenden politischen und historischen Denker der europäischen Renaissance. Seine Texte gehen auf unmittelbare Erfahrung erregender Zeitgeschichte zurück. ...
Volker Reinhardt arbeitet in seiner Darstellung von Leben und Werk des florentinischen Politikers Francesco Guicciardini (1483-1540) die Zeitgebundenheit ebenso wie die Aktualität einer faszinierenden Ideenwelt am Beginn der Moderne heraus.Francesco Guicciardini (1483-1540), florentinischer Patrizier, Provinzgouverneur im Kirchenstaat und von 1523 bis 1527 einer der einflußreichsten Berater Papst Clemens' VII. Medici, ist einer der herausragenden politischen und historischen Denker der europäischen Renaissance. Seine Texte gehen auf unmittelbare Erfahrung erregender Zeitgeschichte zurück. Erlebt und reflektiert werden nicht weniger als drei innere Revolutionen von Florenz und vor allem die Katastrophe des Sacco di Roma von 1527, die Plünderung und Verwüstung der Ewigen Stadt, welche auch die persönliche Existenz Guicciardinis zutiefst erschüttert. Ausgehend von diesen äußeren Umbrüchen, welche die verbrieften Werte von Staat und Gesellschaft hinfällig erscheinen lassen, stößt Guicciardini durch unablässiges Hinterfragen der Tradition und des Scheins schließlich in intellektuelles Neuland vor. Er entwickelt eine Theorie der Staatsräson, die das unbegrenzte Selbsttäuschungspotential des Menschen für eine zugleich starke und milde politische Ordnung nutzbar machen möchte, und eine Religionskritik, welche die menschliche Erkenntnis auf die natürlichen Dinge beschränkt. Seine eigentliche Entdeckung aber ist der alles umfassende, die Lebens- und Vorstellungswelten gleichermaßen ergreifende Wandel des Menschen in der Zeit: Geschichte als Aufbruch ins Unbekannte. Die hier vorgelegte Studie verklammert in methodisch neuartiger Weise Leben und Werk, deutet die Texte als Aufdeckung unauflöslicher Widersprüche zwischen Leben und Moral, stellt Autor und Werk in einen auf dem neuesten Stand der Forschung revidierten Zeitrahmen - und arbeitet auf diese Weise Zeitgebundenheit wie Aktualität einer faszinierenden Ideenwelt am Beginn der Moderne heraus.Volker Reinhardt ausgezeichnet mit dem »Golo-Mann-Preis für Geschichtsschreibung« 2013