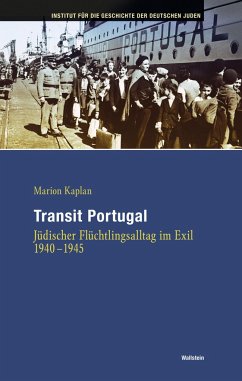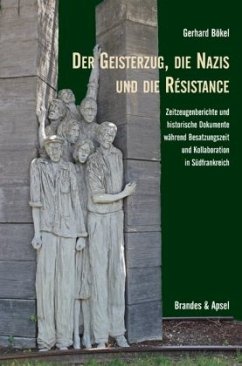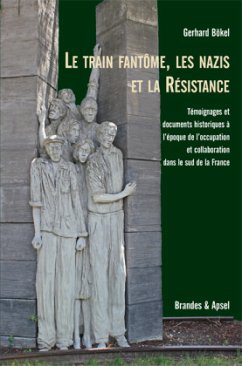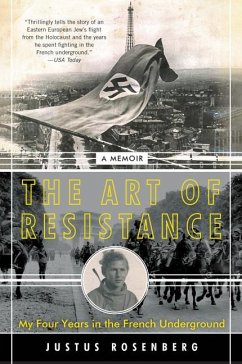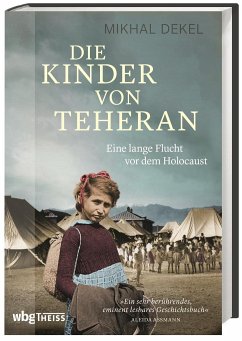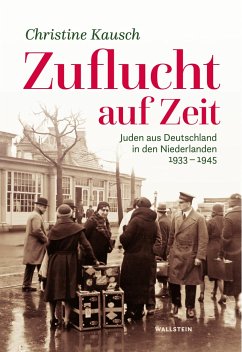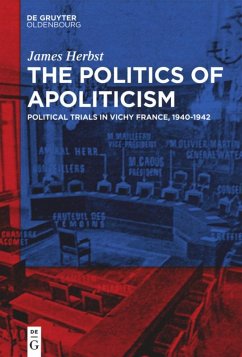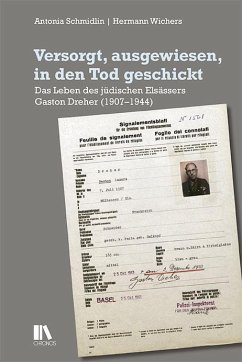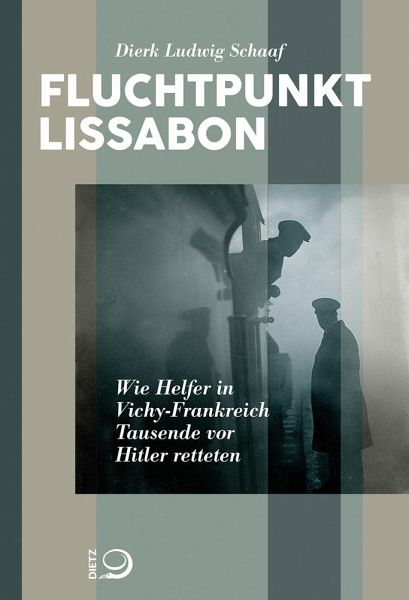
Fluchtpunkt Lissabon
Wie Helfer in Vichy-Frankreich Tausende vor Hitler retteten
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
32,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Hannah Arendt, Marc Chagall, Max Ernst, Otto von Habsburg, Heinrich Mann - sie konnten vor Hitler fliehen. Doch ohne Menschen, die Geld und falsche Papiere beschafften, Verbote ignorierten und taten, was ihr Gewissen verlangte, wäre das nie geglückt. Dieses Buch nimmt erstmals die Fluchthelferinnen und -helfer in den Blick und erzählt, wie sie Tausende vor Tod und Lager retteten.Menschen wie Varian Fry und Noel Field, Lisa und Hans Fittko oder Aristide de Sousa Mendes schreckten nicht vor Bestechung, Schwarzmarkt oder Visafälschung zurück, um Verfolgten in Vichy-Frankreich einen Weg in di...
Hannah Arendt, Marc Chagall, Max Ernst, Otto von Habsburg, Heinrich Mann - sie konnten vor Hitler fliehen. Doch ohne Menschen, die Geld und falsche Papiere beschafften, Verbote ignorierten und taten, was ihr Gewissen verlangte, wäre das nie geglückt. Dieses Buch nimmt erstmals die Fluchthelferinnen und -helfer in den Blick und erzählt, wie sie Tausende vor Tod und Lager retteten.Menschen wie Varian Fry und Noel Field, Lisa und Hans Fittko oder Aristide de Sousa Mendes schreckten nicht vor Bestechung, Schwarzmarkt oder Visafälschung zurück, um Verfolgten in Vichy-Frankreich einen Weg in die Freiheit zu ebnen. Damit gingen sie oft große persönliche Risiken ein. Manche zahlten einen hohen Preis. Dierk Ludwig Schaaf hat für die ergreifenden Geschichten dieses Buchs zahlreiche Dokumente und Akten herangezogen, die bisher nicht oder sehr unvollständig ausgewertet wurden. Die Fakten verbindet er mit anekdotischen und reportageartigen Erzähl-Sequenzen.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.