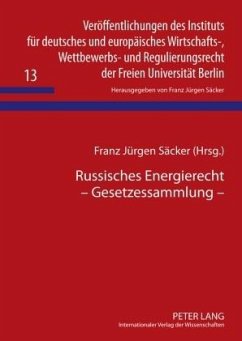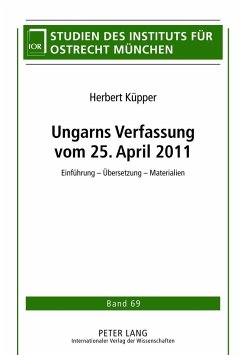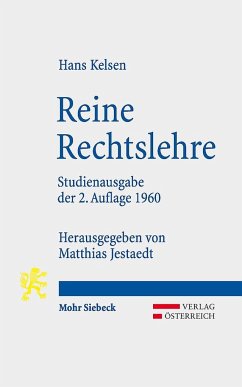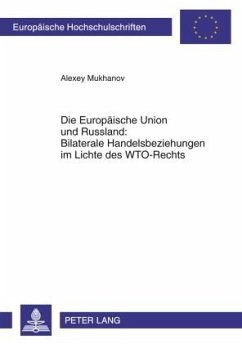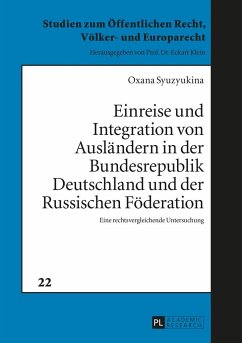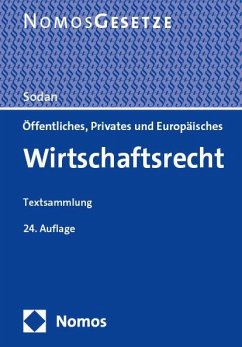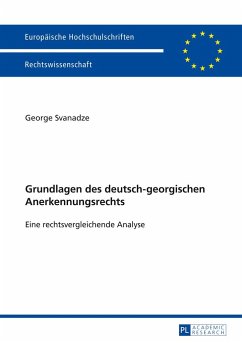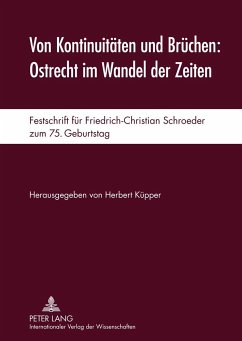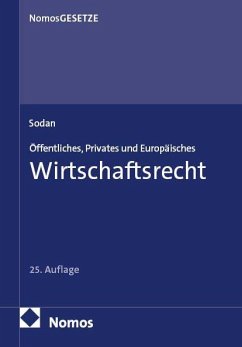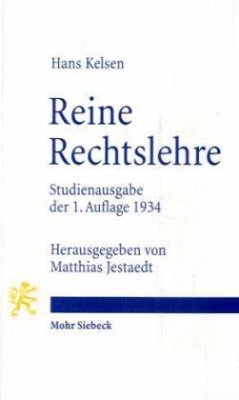Stimmrechtsentzug droht aber nur bei Einstimmigkeit der übrigen Mitglieder (Art. 7), was ein zahnloses Prozedere ist, weil es Sympathie oder gar Zustimmung für Abweichler gibt.
Ein angedrohter Stopp von Fördergeldern zieht dagegen mehr. Elmar Brok fordert von den Mitteleuropäern, die die Aufnahme von Flüchtlingen verweigern, mehr in den Außengrenzschutz zu investieren. Jurgita Baur verweist auf die starke öffentliche Unterstützung der EU-Mitgliedschaft in Litauen, während Polen für Aldona Szczeponek ein "schwieriger Partner" ist. Sie argumentiert historisch: Demokratie und Freiheit hätten sich dort immer wieder behauptet, was sich selbst durch eine Regierung im Namen von "Recht und Gerechtigkeit" nicht verhindern ließe. Ein zugesagter Beitrag über Ungarn fehlt, was die Herausgeber zu der Vermutung verleitete, dass die Regierung einen solchen nicht wünschte.
Peter Hilpold fokussiert auf Österreich vor und nach dem EU-Beitritt (1995). Die Zugehörigkeit zum Parteien- und Verbändestaat zählte mehr als Europa-Kompetenz, wobei sich tief verankerter Austrozentrismus lockern ließ. Konstatiert wird Nachholbedarf im Verhältnis von EU-Rechtskonformität und österreichischer "Realverfassung", der nur durch eine Mentalitätsänderung - auch des Spitzenpersonals - gedeckt werden könne. Ihr jüngster Umgang mit der höchsten Gerichtsbarkeit im Lande weckt Zweifel daran. Als Ersatzidentität für das bedingt beliebte EU-Europa dient das an Wert verloren habende Refugium der "immerwährenden" Neutralität.
Von der 1922/23 verkündeten Paneuropa-Vision des Altösterreichers Coudenhove-Kalergi sind die den Status quo verwaltenden Neuösterreicher als große Nutznießer der "Osterweiterung" weit entfernt. Oskar Peterlini fragt, inwieweit Italien sich von der EU abgewandt habe, und offeriert eine detaillierte Analyse der volatilen Parteienlandschaft auf der Apenninen-Halbinsel. Den starken populistischen Strömungen steht eine stabile Verfassung gegenüber, die an die europäische Einigung gebunden ist. Dennoch hat sich das italienische Parteienspektrum seit den 1990er Jahren von der Konsensdemokratie gelöst. Die Benes-Dekrete und die Bestimmungen des Antifaschistischen Rates der Nationalen Befreiung Jugoslawiens (AVNOJ) boten nach Kriegsende politisch motivierte Rechtsgrundlagen für Unrechtshandlungen, welche nur partiell rückgängig gemacht wurden, zumal sie durch Bestätigung höchstgerichtlicher Urteile fortwirkten. Für Tschechien schlägt Michael Geistlinger eine Versöhnungskommission nach dem Modell Südafrika vor, für Slowenien das Ende der Verschleppung durch Gerichte und für die Verwaltung ein Denationalisierungskonzept. Durch die späte Inkraftsetzung von EU-Grundrechtestandards war es Tschechien und Slowenien möglich, der 2004 als noch kaum rechtsverbindlicher Wertegemeinschaft beizutreten.
Problematisch erwies sich die forcierte "Osterweiterung" bei Rumänien, das trotz unerfüllter Kopenhagener Aufnahmekriterien (1993) EU-Mitglied wurde (2007). Erst die Wahl des liberalen Proeuropäers Klaus Johannis zum Staatspräsidenten (2019) war ein Zeichen der Hoffnung auf dem Weg zu mehr Korruptionsfreiheit, wie Monica Vlad ausführt. Seit 2015 trägt Griechenland als EU-Mitglied die Hauptmigrationslast. Sein Beispiel lehrt, dass EU-Maßnahmen und mitgliedstaatliches Recht weder einheitlich noch europarechtskonform sind, wie Theodora Antoniou zeigt. In Belarus erhöhte sich russischer Einfluss, zumal die EU zweitrelevantester Handelspartner und wichtigster Investor wurde. Die aus einer Zollunion von 2010 hervorgegangene, 2015 begründete Eurasische Union mit Kasachstan und Russland (sowie später mit Armenien und Kirgistan) band Minsk immer stärker an Moskau - trotz "Östlicher Partnerschaft" mit der EU. Der Beitrag von Vadzim Samaryn wurde vor den Massenprotesten 2020 gegen den zweifelhaften Wahlsieger Lukaschenko verfasst.
Fest steht für die Mehrheit des demokratisch gesinnten Belarus, keine EU-Mitgliedschaft anzustreben, mit Russland verbunden zu bleiben sowie den Status eines souveränen und unabhängigen Staates zwischen Ost und West einzunehmen, aber auch liberale und rechtsstaatliche Verhältnisse zu wünschen. In der letzten Absicht können eigentlich nur die EU und ihre Mitgliedstaaten unterstützen, wobei die Balten Sanktionen gegen das System des letzten Diktators in Europa für wenig hilfreich erachten.
Türkisches Wirtschaftswachstum, geopolitische Veränderungen im Zuge des "arabischen Frühlings", militärisches Eingreifen in den Syrienkrieg und der Übergang zum Präsidialsystem schufen neue Prioritäten für den aufstrebenden Mann am Bosporus, der sich vom Reformkurs und Rechtsstaat abwandte.
Gilbert H. Gornig resümiert, dass die EU "nicht als eine wirklich einheitliche Werte- oder Kulturgemeinschaft" zu begreifen sei, jedoch der "Kern für einen gemeinsamen Grundwertebestand" existiere. Um drohende Entkernung abzuwenden, ist Anpassungszwang zur Wertekonformität unerlässlich. Wie auf innerstaatlicher sind auch auf gemeinschaftlicher Ebene die Regeln der Mehrheitsgesellschaften und ihrer Mitglieder als normgebend zu akzeptieren und zu leben. Alles andere wäre nicht nur grundrechtswidrige Missachtung und ideologisch-motivierte Verkehrung der Realitäten, sondern auch eine demokratiepolitische Unverträglichkeit. Der Band bietet eine fundierte Bestandsaufnahme zum Thema. MICHAEL GEHLER
Gilbert H. Gornig/Peter Hilpold (Hrsg.): Europas Grundrechte auf dem Prüfstand. Unter besonderer Berücksichtigung der Länder Mittel- und Osteuropas.
Duncker & Humblot, Berlin 2021. 329 S., 89,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
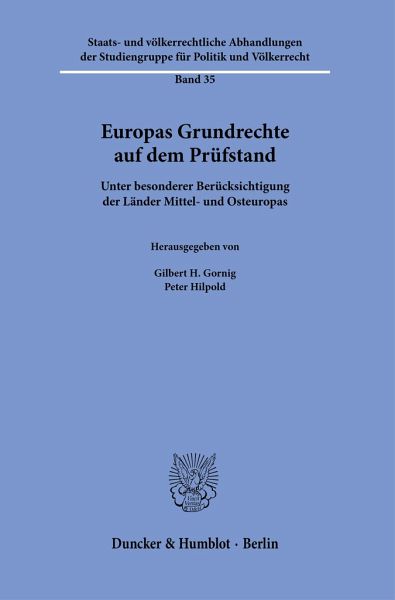





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.10.2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.10.2021