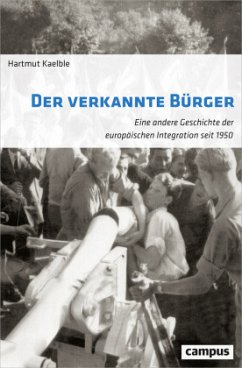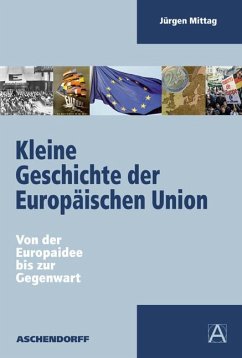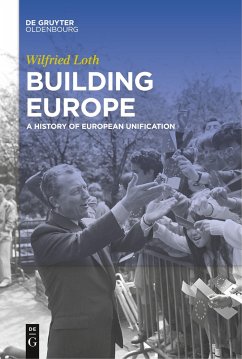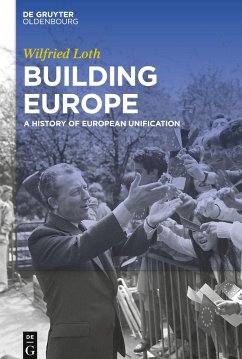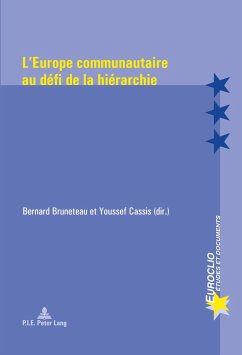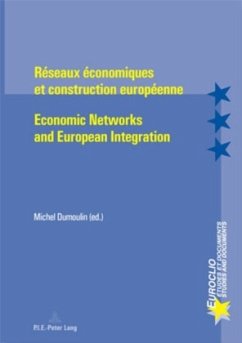Revanchismus hervorzurufen? Dazu Blum: "Um den Widerspruch zu lösen und um die Unschädlichkeit Deutschlands in einem friedlichen und gesicherten Statut zu erreichen, gibt es einen einzigen Weg: die Eingliederung der deutschen Nation in eine internationale Gemeinschaft."
Mit diesem Zitat beginnt Wilfried Loth, der "Altmeister der europäischen Integrationsgeschichte", seine "unvollendete Geschichte" der Einigung Europas. Er legt in acht Kapiteln die Summe seiner Europa-Forschungen vor: (1) Gründerjahre 1948 bis 1957, (2) Aufbaujahre 1958 bis 1963, (3) Krisen 1963 bis 1969, (4) Erweiterung 1969 bis 1975, (5) Konsolidierung 1976 bis 1984, (6) Amsterdam 1984 bis 1992, (7) Von Maastricht nach Nizza 1992 bis 2001, (8) Verfassungsstreit und Eurokrise 2001 bis 2012. Detailliert widmet er sich in den ersten Kapiteln den Themen, deren Erforschung weit fortgeschritten ist: Schuman-Plan, Europäische Verteidigungsgemeinschaft, Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), Beitritt Großbritanniens.
Alles begann mit dem Kalten Krieg und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Der amerikanische Außenminister Dean Acheson brachte es im Oktober 1949 auf den Punkt: "Frankreich, und nur Frankreich, kann die entscheidende Führungsrolle übernehmen, um Westdeutschland in Westeuropa zu integrieren." Und das hieß auch: zu kontrollieren. Sieben Monate später verkündete Frankreichs Außenminister Robert Schuman den nach ihm benannten Plan, eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu schaffen. Der Schuman-Plan war der Weg zu einer deutsch-französischen Annäherung, die wiederum Voraussetzung für eine Integration Europas unter Einschluss der Bundesrepublik war, ganz im Sinne von Achesons Überzeugung, dass "ein Europa ohne Deutschland wie ein Körper ohne Herz" sei.
Als im Juni 1950 Nordkorea den Süden angriff, wurde dies in Washington als Beginn einer großangelegten kommunistischen Offensive gesehen, der entschlossen entgegengetreten werden musste. Die Amerikaner forderten zehn deutsche Divisionen. Frankreich lehnte zu diesem Zeitpunkt noch jede deutsche Wiederbewaffnung kompromisslos ab und legte einen eigenen Plan vor: die Bildung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. 1952 wurden die entsprechenden Pläne unterzeichnet. Sie sahen den Aufbau einer europäischen Armee vor, aber eben auch eine politische Gemeinschaft, ein entscheidender Schritt hin zur Integration Europas. Das Projekt scheiterte im August 1954 am Widerstand Frankreichs.
Der Gedanke einer europäischen Integration wurde dann von den Beneluxländern und Italien aufgegriffen. Man suchte Einigungsprojekte im wirtschaftlichen Bereich, die ohne großen Widerstand durchgeführt werden konnten. Am Ende dieser Phase stand die Gründung der EWG im März 1957, von der Konrad Adenauer gegenüber Wirtschaftsminister Ludwig Erhard meinte, sie sei das "notwendige Sprungbrett" für die Bundesrepublik, "um überhaupt wieder in die Außenpolitik zu kommen". Die europäische Integration sei vor allem notwendig, weil die Vereinigten Staaten von Amerika sie als Ausgangspolitik ihrer ganzen Europapolitik betrachteten "und weil ich genau wie Sie die Hilfe der Vereinigten Staaten als absolut notwendig für uns betrachte".
In Paris regierte wenig später jemand, der das anders sah und die Vereinigten Staaten herausforderte: General Charles de Gaulle. Auf der inzwischen berühmten Pressekonferenz am 14. Januar 1963 kam ein dreifaches Nein des Generals: Nein zum Beitritt Großbritanniens zur EWG, Nein zum britisch-amerikanischen Abkommen für eine multilaterale Atomstreitmacht und Nein zum amerikanischen Angebot an Paris, Polaris-Raketen zu liefern. Großbritannien war für de Gaulle das Trojanische Pferd der Amerikaner, um die EWG von den Amerikanern abhängig zu machen.
Der General ist einer von Loths Lieblingspolitikern; er untermalt das mit wunderbaren Zitaten. Als der Deutsche Bundestag 1963 dem deutsch-französischen Vertrag eine Präambel voranstellte, die das Ende eines Europas unter de Gaulles Führung bedeutete, kommentierte der das im Ministerrat folgendermaßen: "Die Amerikaner versuchen, unseren Vertrag seines Inhalts zu berauben. Sie wollen ein leeres Gehäuse daraus machen. Und warum das alles? Weil deutsche Politiker Angst haben, nicht genug vor den Angelsachsen zu kriechen! Sie benehmen sich wie Schweine! Sie hätten es verdient, dass wir den Vertrag aufkündigen und uns in einer Umkehr der Bündnisse mit den Russen verständigen." Der General trat 1969 ab, vier Jahre später traten Großbritannien, Dänemark und Irland der EWG bei.
Für den Zeitraum 1976 bis zur Gegenwart (5. bis 8. Kapitel) sind Archive und Nachlässe bislang nur sehr punktuell erschlossen. Hier war nach Loths eigener Aussage "viel Pionierarbeit" zu leisten. Und wenn Akten fehlen, dann fehlen auch interessante Einzelheiten und griffige Zitate. Die Geschichte der europäischen Integration wird zunehmend "langweilig", obwohl fast jede der europapolitischen Maßnahmen den einzelnen Bürger betrafen beziehungsweise betreffen. Etwa 1977, als Frankreichs Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt mit dem Europäischen Währungssystem eine Zone stabiler Wechselkurse schaffen wollten. Das System trat 1979 in Kraft. Oder die Direktwahl des Europäischen Parlaments im selben Jahr. 1990 forcierte Frankreich die Vertiefung der europäischen Integration und erwartete die deutsche Zustimmung dafür als Beweis für die Integrationsbereitschaft auch des vereinigten Deutschlands. Dafür stand Helmut Kohl.
In den folgenden Jahren gab es erstaunliche Fortschritte: Grenzkontrollen fielen, die Zahl der Mitglieder stieg auf 28, von denen 17 den Euro als gemeinsame Währung 2002 - manche meinten, zu früh - einführten. Die entsprechende Krise ließ nicht lange auf sich warten. Allenthalben ist jedenfalls ein Ende der EU-Euphorie festzustellen. Und von daher gilt mehr denn je, was die EU-Staats-und Regierungschefs bereits 2001 - also vor dreizehn Jahren! - in der "Erklärung von Laeken" feststellten, nämlich: "Die Bürger finden, dass alles zu sehr über ihren Kopf hinweg geregelt wird, und wünschen eine bessere demokratische Kontrolle. Die EU muss demokratischer, transparenter und effizienter werden." Fazit: Ein aufklärerisches Werk. Pflichtlektüre für alle, die an der unvollendeten Geschichte Europas (ver-)zweifeln.
ROLF STEININGER
Wilfried Loth: Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2014. 512 S., 39,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
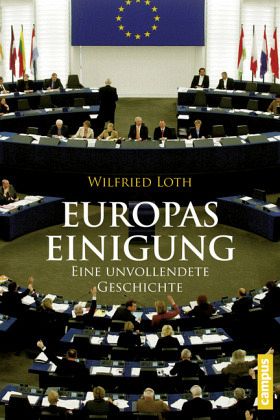





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.04.2014
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.04.2014