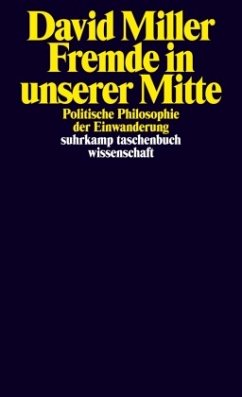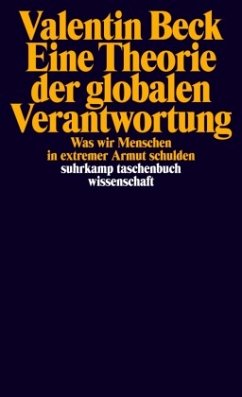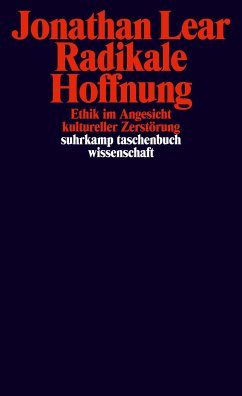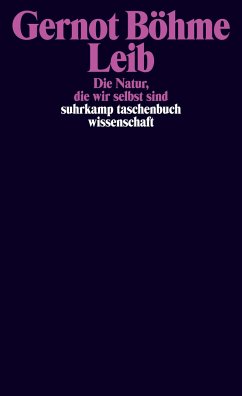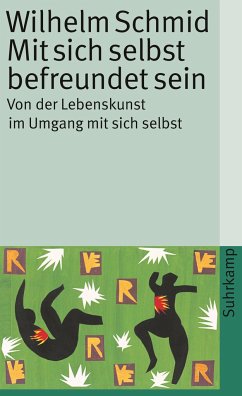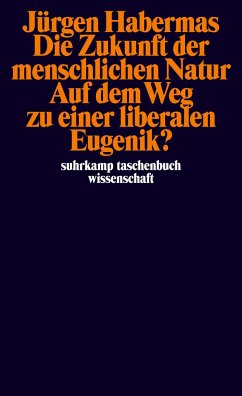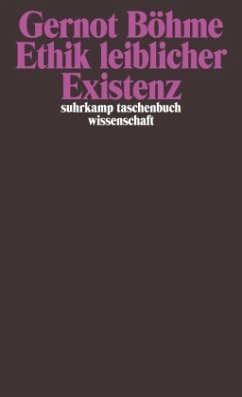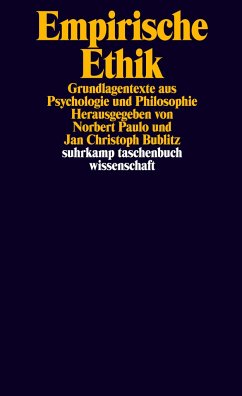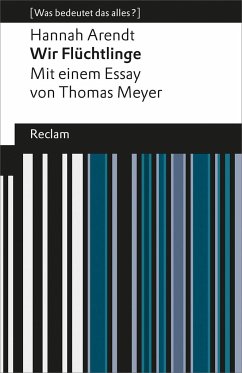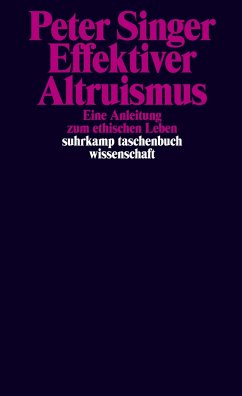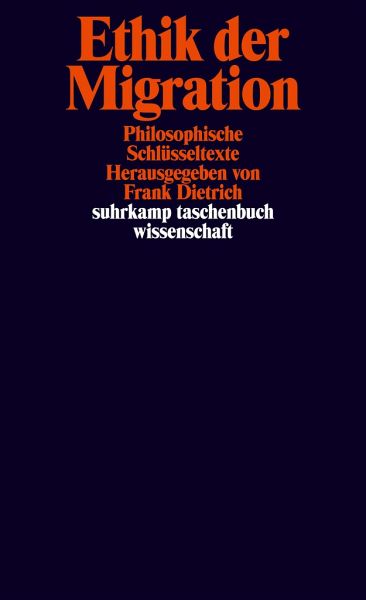
Ethik der Migration
Philosophische Schlüsseltexte
Herausgegeben: Dietrich, Frank
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
18,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Militärische Gewalt, politische Verfolgung und mangelnde ökonomische Perspektiven veranlassen eine stetig wachsende Zahl von Menschen, ihr Heimatland zu verlassen. Die Beantwortung der Frage, ob beziehungsweise in welchem Umfang wohlhabende Staaten zur Aufnahme von Migranten verpflichtet sind, stellt eine der drängendsten ethischen Herausforderungen unserer Zeit dar. Der Reader präsentiert Schlüsseltexte der philosophischen Diskussion, u. a. von Joseph Carens, David Miller und Peter Singer, und vermittelt so einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Positionen, die im Streit um e...
Militärische Gewalt, politische Verfolgung und mangelnde ökonomische Perspektiven veranlassen eine stetig wachsende Zahl von Menschen, ihr Heimatland zu verlassen. Die Beantwortung der Frage, ob beziehungsweise in welchem Umfang wohlhabende Staaten zur Aufnahme von Migranten verpflichtet sind, stellt eine der drängendsten ethischen Herausforderungen unserer Zeit dar. Der Reader präsentiert Schlüsseltexte der philosophischen Diskussion, u. a. von Joseph Carens, David Miller und Peter Singer, und vermittelt so einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Positionen, die im Streit um eine ethisch gerechtfertigte Migrationspolitik vertreten werden.