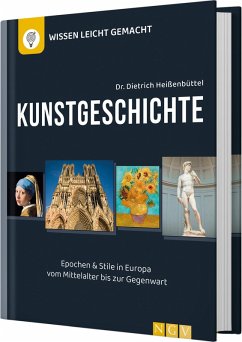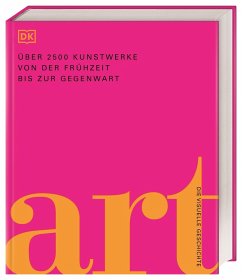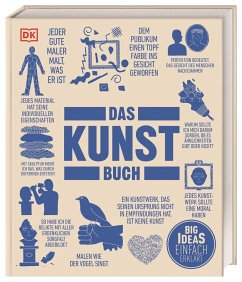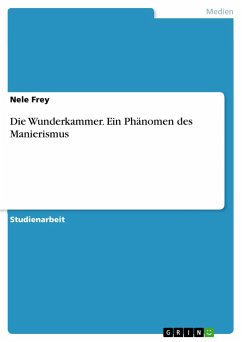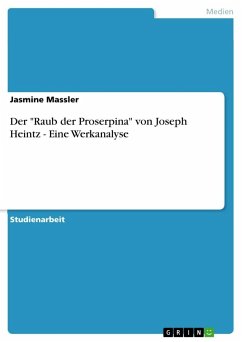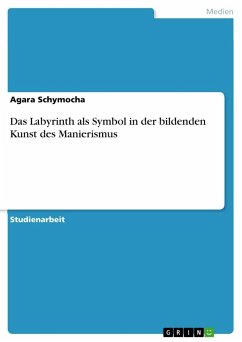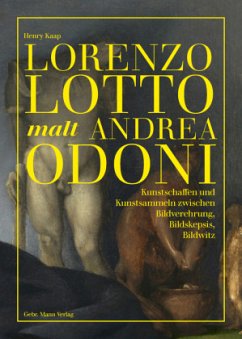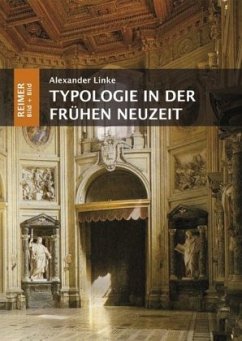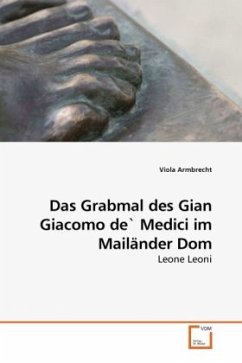den Hintergrund treten lassen.
Deshalb ist es erfreulich, dass jetzt zwei frühere Texte des Autors noch einmal samt einem instruktiven Nachwort erscheinen. Der erste Beitrag gilt dem Antwerpener Maler Georg Hoefnagel, dessen Studien von Pflanzen, Insekten und Seetieren Kris als Ausdruck eines im 16. Jahrhundert einsetzenden wissenschaftlichen Naturalismus deutet. Als Hoefnagel 1577 in Begleitung des Geographen Abraham Ortelius Italien bereiste, galt sein Interesse weniger den antiken Denkmälern als den Schwefelquellen bei Pozzuoli und dem Kratersee von Agnano. Es sei eben nicht die Erlebniskraft des Künstlers, die Hoefnagel umgetrieben habe, folgert Kris, sondern der Geist eines Forschungsreisenden.
Kris versteht diese Haltung als Ausdruck eines Zeitstils des 16. Jahrhunderts, der eine Intellektualisierung und Verwissenschaftlichung der Kunst mit sich bringe. "Bei aller Meisterschaft der Darstellung sind diese Blätter gewiss nicht als ,Kunstwerke' aufzufassen." Die scheinbare Strenge, mit der Kris hier urteilt, kann leicht täuschen. Denn seine Absicht ist es gerade nicht, den Miniaturen Hoefnagels den Eintritt in die Kunstgeschichte zu versagen, sondern ihnen ganz im Gegenteil dort ein Bleiberecht zu gewähren. Die von Kris festgestellte "Kunstlosigkeit" der Miniaturen soll sie nicht aus der kunstgeschichtlichen Betrachtung ausschließen, sondern genau umgekehrt die Kategorien des Fachs erweitern. Wie Bettina Uppenkamp in ihrem Kommentar hervorhebt, argumentiert Kris hier in der Tradition der Wiener Schule der Kunstgeschichte und ihrer Abkehr von einer normativen Geschichtsschreibung, die vor allem Werke der Hochkunst kennt. Mitunter hat es den Anschein, als müsse Kris auch sich selbst noch von der Notwendigkeit dieses erweiterten Blicks überzeugen. Möglicherweise, so räumt er ein, laufe seine Studie Gefahr, am Ende gar kein kunstgeschichtlicher, sondern ein kulturgeschichtlicher Beitrag zu sein.
Die ein Jahr später erschienene Studie zur Verwendung des Naturabgusses in der Kunst des sechzehnten Jahrhunderts formuliert schon in den ersten Sätzen ungleich offensiver. Es seien die Wertmaßstäbe der eigenen Gegenwart, die das Vergangene wahlweise als Blüte oder Verfall erscheinen ließen und ihren Ausdruck oftmals in begrifflichen Unschärfen und den "völlig untauglichen Stilnamen der Kunstgeschichte" fänden. So gilt Kris der Stempel "Manierismus" als fragwürdiger Versuch, die neuen Stilphänomene des sechzehnten Jahrhunderts in den Griff zu bekommen. Auch in der Wahl seines Forschungsobjekts geht der Autor hier einen Schritt über die frühere Studie hinaus. Denn mit dem Naturabguss ist ein mechanisches Verfahren angesprochen, das den dargestellten Objekten einen entscheidenden Eigenanteil an der Verwirklichung des Werks zugesteht. Die von Pflanzen und Lebewesen abgenommenen Formen offenbaren eine Naturtreue, die den Objekten selbst entliehen ist.
Vor allem den Arbeiten des Nürnberger Goldschmieds Wenzel Jamnitzer und des französischen Keramikers und Gartenarchitekten Bernard Palissy gilt Kris' Aufmerksamkeit. Palissys Schüsseln mit Tier- und Pflanzenabgüssen hatten ihren festen Ort in den Kunst- und Wunderkammern der Zeit, da sie die Grenze zwischen Künstlichkeit und Natur verwischten. Auch die künstliche Grotte, die Palissy im Garten der Pariser Tuilerien installierte, schmiegte sich kaum unterscheidbar an den natürlichen Fels, und die emaillierten Reptilien, die sie bewohnten, sollten mit ihren lebensechten Artgenossen in Verbindung treten. Kris deutet die Grotte als bewusste "Travestie der Architektur", in der Palissy ein Stück Natur adaptierte und dabei zugleich die unbedingte Vorbildlichkeit der antiken Kunst relativierte.
Längst liegen neuere Forschungen zu den von Kris behandelten Künstlern vor. So hat Horst Bredekamp die Grotte Palissys in seinen Studien zur Kunst- und Wunderkammer als ein Labor beschrieben, in dem Sammeln, Forschen und Gestalten zu neuer Einheit zusammenkamen. Andrea Klier hat die Schlangen und Kriechtiere auf den Essgeschirren Palissys als Beschwörung und gleichzeitige Bannung einer sündhaften und schrecklichen Natur gedeutet. Robert Felfe schließlich konnte zeigen, wie sehr es beim Naturabguss nicht nur auf das fixierte Endprodukt, sondern auch auf den Herstellungsprozess selbst ankam: Das künstlerische Artefakt konnte seinen Schein der Lebendigkeit nur erlangen, nachdem der lebendige Tierkörper im Guss getötet und zerstört worden war.
Diese Durchdringung von Neuschöpfung und Zerstörung hatte Kris noch nicht gesehen. Und doch machen die neuen Erkenntnisse die Lektüre seiner Studien keineswegs hinfällig. Denn ebenso bemerkenswert wie die Pionierfunktion der Texte ist ihre methodische Aktualität. Es ist noch nicht allzu lange her, dass auch die Fotografie als mechanischer Abdruck der Dinge galt, der in den Curricula der Kunstgeschichte keinen Ort finden konnte. Und angesichts der Allgegenwart medial erzeugter Bilder stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten und Beschränkungen des klassischen Kunstbegriffs auch heute.
Auf diese Herausforderung hat Kris in seiner Zeit mit einer intellektuellen Haltung reagiert, die zugleich mit dem Forschungsgegenstand auch die Bedingungen der eigenen Methoden reflektierte - und man könnte sagen: die auch nach deren Grenzen suchte. Denn in seiner Studie zum Naturabguss hatte Kris seine stilgeschichtliche Ausgangsfrage letztlich bis an den Rand ihrer Zuständigkeit gebracht. Jeder Stil setzt ein Formbewusstsein voraus. Die Natur aber hat ein solches Bewusstsein nicht. Sie besitzt keinen Willen zur Kunst und hat deshalb auch keinen Stil. Mit dem Naturabguss taxierte Kris zugleich auch eine Grenze der Stilgeschichte.
PETER GEIMER
Ernst Kris: "Erstarrte Lebendigkeit". Zwei Untersuchungen.
Vorgestellt von Bettina Uppenkamp. Diaphanes Verlag, Zürich 2012. 158 S., Abb., br., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
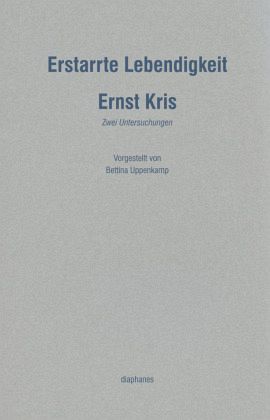




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.10.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.10.2012