auf Klibansky gelenkt und seine wirklich fundamentalen Leistungen doch eher verdeckt.
Nicht, als sei Melancholie kein überaus wichtiges Thema. Auch die alten Lehren vom Einfluß des Saturn verdienen, mit Respekt und Kenntnissen studiert zu werden. Aber das Buch hat in Deutschland ein einseitiges Bild des Gelehrten und des Kulturpolitikers Klibansky geschaffen; es gibt nicht entfernt einen Eindruck von der Lebensarbeit dieses großen Forschers und Wissenschaftsorganisators. Doch soeben erscheint seine Autobiographie, drei Jahre nach dem französischen Original. Sie regt an, Klibansky in den größeren Dimensionen zu sehen, in denen sein Lebenswerk steht.
Seine "Erinnerung an ein Jahrhundert" ist knapp und präzis geschrieben. Der Philosophieprofessor verfällt nie ins Philosophastern; er haßt das Vage. Der Text hat die Form einer Unterhaltung mit einem kenntnisreichen Schüler, Georges Leroux, dem es gelingt, die ganze Breite der Aktivitäten Klibanskys zu berühren. Erinnerungsbücher von Philosophen sind oft langweilig; die Autoren merken oft nicht, daß sie gar kein Leben hatten, und ersetzen es durch Wortschwall, ertrinken in Besinnlichkeit und Bücherkram. Nichts davon hier: In rascher Bilderfolge zeichnet sich das Profil eines Intellektuellen in seinem fürchterlichen Jahrhundert ab.
Die autobiographische Skizze eines Lebens zwischen 1905 und dem Erscheinungsjahr 1998, zwischen Paris und Frankfurt, Oxford und Montreal, wird eine kleine Summe des zwanzigsten Jahrhunderts. Das intellektuelle Heidelberg der späten zwanziger Jahre lebt auf, wir bewegen uns im Kreis von Marianne Weber und Karl Jaspers, die Rolle der Intellektuellen 1933 wird detailliert beschrieben, Erfahrungen der Emigration nach London und Oxford kommen zu Wort. Spannend zu lesen die Mitteilungen aus der Kriegszeit: Klibansky war Offizier im englischen Geheimdienst; er hatte unter anderem die Aufgabe, aus deutschen Zeitungen und Propagandareden Nachrichten über die Pläne einer deutschen Atomwaffe zu ermitteln. Von höchstem Interesse sind seine methodologischen Bemerkungen, wie man aus Propagandalügen Wahrheiten ermitteln kann. Das Verfahren dabei sei, findet er, dem des Geschichtsforschers recht ähnlich: "Es gibt keine Propaganda ohne einen Kern von Wahrheit."
Ich stehe nicht an zu behaupten: Klibansky gehört mit Eugenio Garin zu den bedeutendsten Ideenhistorikern der Welt, und beide haben dem Wort den Umfang belassen, den es verdient. Klibansky ist vom Fach Historiker der Ideen und der Wissenschaften. Er hat die wichtigsten Schritte in der Erforschung Meister Eckharts und des Nikolaus von Kues unternommen, die es im vergangenen Jahrhundert gab. Er hat die Fortwirkung der Antike im europäischen Denken studiert; er hat - detailliert, nicht obenhin - die Kontinuität der platonischen Tradition bewiesen, auch für die Zeiträume, die früher als aristotelisch galten. Er hat eine Reihe wichtiger Quellenfunde gemacht, vor allem zur Spätantike, zum Mittelalter und zur Renaissance. Er hat Philosophie immer im Kontext der Wissenschaften, aber auch der Kunst und des Aberglaubens analysiert. Er hat in Zeiten radikaler Traditionsbrüche den Begriff der Tradition inhaltlich gefüllt und in der Einzelforschung fruchtbar gemacht - als Tradition des Platonismus, des Humanismus, des Toleranzdenkens. Andere haben den Begriff rhetorisch aufgeblasen und überhöht; er hat ihn konkretisiert und in seiner Vielfalt gezeigt.
Dabei ergaben sich Resultate, die dem allgemeinen Bildungsgerede strikt widersprechen. Sie sind um so bedeutender, als sie dem Arbeitsleben eines unermüdlichen Handschriftenforschers entspringen. Sie liegen abseits der Heerstraßen; und es besteht die Gefahr, daß sie eifrig überlesen werden.
Da ist zuerst der Zusammenhang von Geschichte und Philosophie. Klibansky kritisiert die Historiker, die zu Antiquitätenhändlern verkommen, weil sie glauben, sie kämen ohne Theorie aus. Er kritisiert noch heftiger die Philosophen, die sich in einem Vakuum bewegen, weil sie sich über die historische Bedingtheit ihres Standpunktes keine Rechenschaft ablegen.
Ein zweites markantes Resultat: Klibansky verwirft die Entgegensetzung Mittelalter-Neuzeit. Man hat jahrelang über die Epochenschwelle gestritten. Wenige Gelehrte haben wie Klibansky von Platon bis Cassirer die Zeitalter durchquert, nicht in handbuchartigen Überblicken, sondern durch Quellenstudien. Er erzählt, er habe bei seinen Studien entdeckt, daß die schulmäßige Etikettierung nach Antike, Mittelalter und Renaissance "grundsätzlich falsch" sei. Darüber sind sich die wenigen wirklichen Quellenforscher inzwischen fast einig, aber es ist unabsehbar, welche Entrümpelung auf unseren Bildungsallgemeinplätzen eingeleitet ist. Wir brauchten nur diese Einsicht des großen Kenners zum Anlaß nehmen, unsere Geschichtsvorstellungen und am Ende wohl auch die Geschichtsbücher zu revidieren.
Noch ein drittes Ergebnis. Heute glaubt jeder zu wissen, daß Meister Eckhart ein "Mystiker" war. Die Substantive "Eckhart" und "Mystiker" sind zusammengebacken, man kann dagegen protestieren und auf die Quellen verweisen, soviel man will. Aber nun liest man beim bedeutendsten Eckhart-Forscher des zwanzigsten Jahrhunderts, er fände den Ausdruck "deutsche Mystik" verschwommen und undeutlich, eine "Etikettierung, die mehr verdunkelt als erhellt". Auch hier fordert Klibansky - mit leichter Hand, ohne alle Erregung - eine Revision.
Das sind nur drei Beispiele aus einer großen Ernte. Sie werden in dem Lebensrückblick prägnant formuliert, nicht umständlich entwickelt. Wer will, kann daran weiterarbeiten. Doch das Buch ist nicht nur für Fachleute geschrieben. Für jeden Leser öffnet sich hier ein Leben, das durch Judenverfolgung und Krieg fast zerstört worden wäre, das sich aber dann in kosmopolitischer Weite entfalten konnte. Kaum ein bedeutender Name des kulturellen Lebens, der hier nicht in persönlicher Begegnung vorkommt, von Stefan George zu Einstein, von Gundolf zu Kolakowski, von Cassirer zu Quine.
Das Buch enthält fast keine Polemik. Das ist selten in der Autobiographie von Philosophen. Diese fühlen fast immer das Bedürfnis, zu sagen, die Philosophie der Fachkollegen sei "eigentlich" gar keine Philosophie, sondern deren Zerstörung. Nicht so bei dem Toleranzdenker Klibansky. Doch en passant, vor allem gegen Ende des Buches, grenzt er sich auch ab: Die Frankfurter Schule, deren Einfluß er anerkennt, behagt ihm nicht; zuviel soziologische Substantive verdecken die konkrete, vor allem die historische Analyse. Sie erzeugt keine Quellenforscher, allenfalls auf dem Weg der Abstoßung.
Eine zweite Abgrenzung ist noch folgenreicher: Wenn Philosophie praktisch-politische Bedeutung haben soll, wenn sie etwas mit Menschenrechten zu tun hat, so braucht sie einen normativen Begriff von "Vernunft". Es gibt keinen aktiven Humanismus ohne einen Rest von Platonismus. Daher klingt Klibanskys Autobiographie aus mit einer Polemik gegen neuere Versuche der Vernunftkritik. Ein Riese der Ideenhistorie wehrt sich gegen den historischen Relativismus. Die Untaten seines Jahrhunderts waren so ungeheuerlich, daß Philosophie überflüssig würde, hätte sie nicht gute Gründe für individuelle Freiheit und Toleranz. De facto ist sie wehrlos gegen Gewalt und übermächtige Staaten, aber sie ist nicht wertlos, solange sie ein Bewußtsein individueller Selbstbestimmung fördert. Auch diese Position ist, Klibansky zufolge, an geschichtliche Bedingungen gebunden. Sie stellt sich dem Konflikt von Humanismus und historischem Bewußtsein.
Klibansky - das ist Lessing, der Gelehrte, der Büchernarr, im zwanzigsten Jahrhundert, eine einzigartige, fruchtbare Koinzidenz. Seine Autobiographie ist leicht, und sie ist informativ. Sie handelt von der Wissenschaft und von Geschichte. Und sie ist ein Buch über Deutschland, von innen wie von außen besehen. Ein außerordentlicher Ausgangspunkt für theoretische und praktisch-politische Reflexionen. Was bleibt, ist die Trauer, daß die deutsche Universität sich einem Forscher wie Klibansky auch nach dem Krieg nicht wieder geöffnet hat. Es gibt Leute, die sagen, sie sei seiner nicht wert.
KURT FLASCH
Raymond Klibansky: "Erinnerung an ein Jahrhundert". Gespräche mit Georges Leroux. Aus dem Französischen von Petra Willim. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2001. 287 S., Abb., geb., 48,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
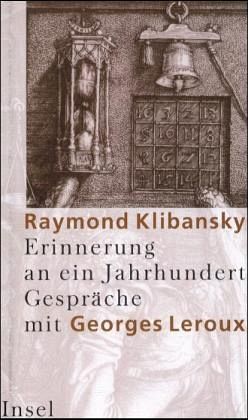




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.08.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.08.2001