Nicht lieferbar
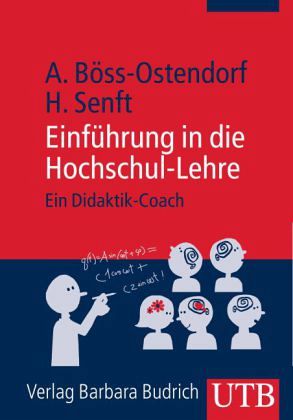
Einführung in die Hochschul-Lehre
Ein Didaktik-Coach
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Mit diesem Coach in Buchform bekommen Hochschullehrende Unterstützung bei der Entfaltung ihrer eigenen Lehrkompetenz. In vier Schritten vermitteln die Autoren zentrale didaktische Fähigkeiten. Auf der Grundlage einer Lehre, die sich am Lernen der Studierenden orientiert, hilft der Didaktik-Coach dabei, elementare Fertigkeiten auszubilden: die eigene Kontaktfähigkeit weiter zu entfalten, ein von der Gehirnforschung gestütztes Lernverständnis zu entwickeln, sich mit Hilfe gruppenanalytischer Erkenntnisse sicher in Seminaren zu bewegen und schließlich eine Methodenkompetenz zu erwerben, die...
Mit diesem Coach in Buchform bekommen Hochschullehrende Unterstützung bei der Entfaltung ihrer eigenen Lehrkompetenz. In vier Schritten vermitteln die Autoren zentrale didaktische Fähigkeiten. Auf der Grundlage einer Lehre, die sich am Lernen der Studierenden orientiert, hilft der Didaktik-Coach dabei, elementare Fertigkeiten auszubilden: die eigene Kontaktfähigkeit weiter zu entfalten, ein von der Gehirnforschung gestütztes Lernverständnis zu entwickeln, sich mit Hilfe gruppenanalytischer Erkenntnisse sicher in Seminaren zu bewegen und schließlich eine Methodenkompetenz zu erwerben, die deshalb effizient ist, weil sie sich an den Bedürfnissen der Lerngruppe orientiert. Die Autoren sind ausgewiesene Fachleute für Coaching und Beratung im Hochschulbereich. Methoden für die professionelle Lehre an Hochschulen: So macht die Lehre Freude!




