beantragt. Hat doch das Jobcenter selbst schuld, wenn es der Beamte dort nicht aushält.
Scott Körber wäre ein gefundenes Fressen für Nadja Klinger und Jens König. Die Berliner Autoren sind zwei Jahre nach der Einführung von Hartz IV durchs Land gefahren und haben einen "wahren Bericht über die neue Armut in Deutschland" geschrieben ("Einfach abgehängt", Rowohlt Berlin). Sie haben mit Arbeitslosen, Obdachlosen, mit in Armut gefallenen Akademikern sowie mit Leuten gesprochen, die beruflich mit ihnen zu tun haben. Der Fall des Berliner Beamten Körber würde bei ihnen für die hilflose Bürokratie stehen. Die arbeitslose Ingenieurin Elke Reinke kommt tatsächlich in dem Buch vor. Ihr haben Hartz IV und die Folgen 2005 zu einem Bundestagsmandat der Linkspartei verholfen; im Buch wie in der Innenpolitik spielt sie die Interessenvertreterin der "neuen Armen".
Wie schwer das ist, zeigte Berlins Wirtschaftssenator Harald Wolf (Linkspartei) wenige Tage vor der Wahl. Er stellte hundert Jobs eines "öffentlich geförderten Beschäftigungssektors" vor. Eine schwierige Konstruktion schafft auf drei Jahre befristete Jobs, die für die Angestellten so funktionieren wie reguläre Stellen mit bescheidenen Gehältern. Es müsse möglich sein, sinnvolle Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu bezahlen, argumentiert Wolf. Die Kritik von links am "neoliberalen" Kurs kam prompt: Das sei auch nichts Besseres als Ein-Euro-Jobs.
Das Armsein, die Armut und die armen Leute kommen in der politischen Debatte oft vor. Häufig wird mit dem Kontrast zwischen dem reichen Deutschland und der bitteren Armut einzelner gearbeitet. Nadja Klinger und Jens König gehen angenehm aufgeklärt mit dieser überholten Vorstellung um: Längst nicht allen armen Leuten wäre mit Geld geholfen.
Beim Thema Armut belauern sich Politik, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Experten. Die einen, wie Kanzler Gerhard Schröder Ende 2004, fordern ein Ende der "Schwarzmalerei". Andere plakatierten: "Hartz IV ist Armut per Gesetz" und gewannen damit, wie die PDS, Wahlen. Und wieder andere, wie der Präsident des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche, Jürgen Gohde, verletzen Tabus. Im Juni hatte er gefordert, die Zahlungen an Langzeitarbeitslose zu senken, damit ein "dauerhaft tragfähiges und finanzierbares Leistungssystem" erhalten werden könne. Er trat zurück - in seiner Position hat man gegen "Sozialabbau" aufzutreten und nicht noch gute Gründe dafür zu finden.
Wer die Armen sind und wie sie leben, hören wir selten. Im Gestrüpp der Zahlen und Relationen - wer weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens hat, ist arm, was auf 17,3 Prozent der Haushalte zutrifft - ist es schwer, sich ein Bild zu machen. Jeder kennt schließlich Schlawiner, die jedes Gesetz zu ihren Gunsten zu nutzen oder zu mißbrauchen verstehen. Aber jeder Politiker, der dafür wirbt, das Arbeitslosengeld II zu senken, damit der Abstand zu den regulären Löhnen schlecht Verdienender nicht zu klein wird, wird hart angegriffen. In der Politik ist es schlechter Ton, nicht mehr Geld für die Schwachen zu verlangen. Mit ihren praktischen Anwälten haben die Armen Glück; niemand muß unter der Brücke schlafen und Hunger leiden, dafür sorgen Suppenküchen und Notunterkünfte. Als Gegenstand politischer Anstrengungen aber ist Armut aus der Mode gekommen.
Die Arbeitsmarktreform von Rot-Grün wurde zum politischen Kampfthema. Ohne Hartz IV und die massiven Ängste vor dem Absturz, die diese Reform weit über den Kreis der Arbeitslosen hinaus schürte, wäre die WASG wohl nicht gegründet worden. Ohne die Fusion mit der WASG hätte die PDS keine Chance, in einer gesamtdeutschen linken Partei weiterzuleben. Ein Konzept gegen die Armut blieben beide schuldig. Immerhin gaben die Links-Bundestagsabgeordneten Katja Kipping und Bodo Ramelow sowie der Wissenschaftler Michael Opielka in einem Aufsatz 2005 zu, allein mit Geld sei es nicht mehr getan. Titel: "Sind wir hier bei ,Wünsch dir was'?" Wo Armut nicht mehr Materielles meint, sondern Ausschluß, Bildungsferne und Sozialhilfe in der dritten Generation, kann Geld kein Heilmittel sein.
Mehr davon erfährt man bei Klinger und König. Dem Wirtschaftswissenschaftler, den unberatene Immobilienkäufe arm gemacht haben, würde ein Lottogewinn helfen. Patrick aber, der von zu Hause und aus Therapien abhaute, der wegen Drogenhandels im Gefängnis saß, dem hilft vor allem seine bewundernswerte Selbstdisziplin - und sein Platz in der "Tages- und Abendschule Köln", in der er doch noch eine Chance bekommen hat.
Vier Prozent der Deutschen sind "chronisch arm". Um Migrantenkinder und andere aus "bildungsfernen Elternhäusern", um Schulabbrecher müßte sich die Politik kümmern. Bis Verhältnisse "chronisch" werden, haben viele an ihrer Festigung mitgewirkt. Um sie zu ändern, müssen viele mittun. Die Leute in "Einfach abgehängt" sprechen für sich selbst. Das Format des Porträts ist klug gewählt, es erlaubt Überraschungen und ein eigenes Urteil. "Das Elend, das man hier erlebt, ist moralisches Elend", sagt etwa die Geschäftsführerin des Rostocker Jobcenters. Ihre Kollegin meint nach einem Gespräch mit einem "Kunden": "Ich hab' ein Problem damit, wenn ein junger Mann in dieser Situation keinen unzufriedenen Eindruck macht."
"Linke verstehen was von Armut, denken die Leute, aber nichts vom Geld", sagte Gregor Gysi kürzlich. Bei Klinger und König liest man es anders: "Hier ein bißchen mehr Geld, dort ein bißchen mehr Gerechtigkeit, dazu ein wenig Umverteilung - so leicht wird es nicht funktionieren." Sie fordern eine "intelligente Armutspolitik", die heraustreten müsse aus der Sozialpolitik. Sie fordern schärfere Blicke auf den einzelnen Fall, eine bessere Bildungspolitik - und den Abschied von der "Lebenslüge", daß jeder von Arbeit leben können muß.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
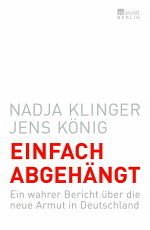





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.10.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.10.2006