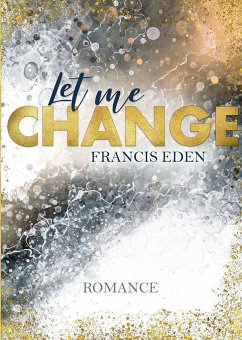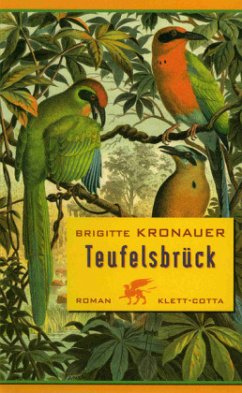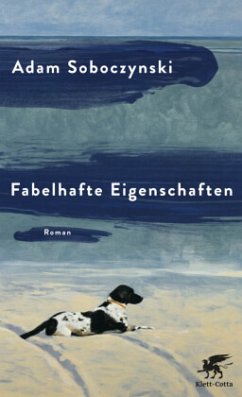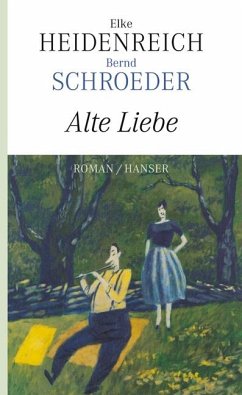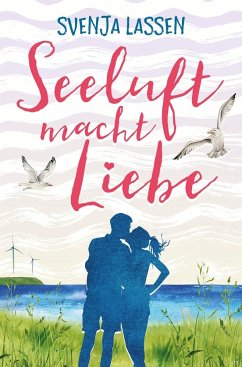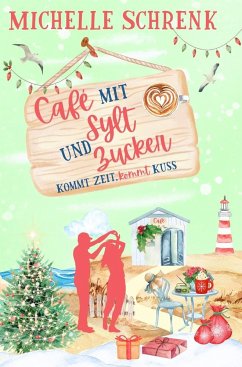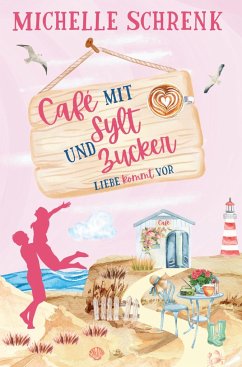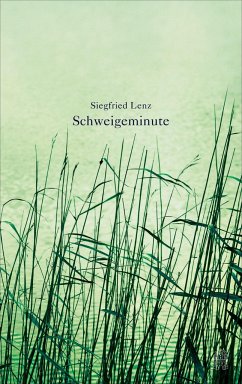Agnostiker und Paläontologe hat er wenig spirituelle Neigungen, aber gegen seine keusche Geliebte kommen weder Gott noch Menschen an. Auch nicht Judith, die blonde Museumspädagogin, mit der Gregor vorher liiert war, nicht Pfarrer Dornkamp, sein mutmaßlicher Nebenbuhler, schon gar nicht die Druidensekte, die Madeleine nach Heidenart roh an die Wäsche und die edle Stirn geht.
Sachen gibt's, warum nicht auch die Liebe zu Sachen und Dingen? Der Neurologe Oliver Sacks kannte einen "Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte". Eine Schwedin, die 1979 die Berliner Mauer heiratete, prägte den Begriff "Objektophilie", und seither melden sich, sehr zur Freude von Psychoanalytikern und Kulturwissenschaftlern, immer öfter Frauen, die sich unsterblich in die Twin Towers verliebt haben wollen, oder Männer, die auf schnuckelige Hammondorgeln, süße Heizungen oder auch schwule Dampfloks stehen. Einem unbelebten Partner, so glauben sie, kann man sich vertrauensvoller nähern und intimer offenbaren als menschlichen Wesen.
Gregor umkreist seine Geliebte so rücksichtsvoll, achtsam und zärtlich, wie es eine Amour fou eben zulässt. Manchmal erlegt er sich sogar freiwillig Verehrungspausen und zölibatäre Beschränkungen auf. Er lässt Madeleine Zeit und Raum für das stumme Ja, und tatsächlich gewährt ihm die offene Kirche nach vielen abgewiesenen Avancen und Balzritualen heiße Liebesnächte auf hartem Betonfußboden. Die Vereinigung von Mensch und posthumaner Steppe, von wässrigen, flüchtigen Proteinen und harter anorganischer Materie, ist für einen Mann, der in Äonen denkt, eine orgasmische Vorstellung. Albig erspart uns anatomische Details, aber nicht ein Trommelfeuer exquisiter Mutterschoß-Metaphern und fossiler Fachtermini. Sein Gregor denkt präkambrisch und "schwitzt karbonisch, wie zu der Zeit, als der Boden, auf dem er stand, noch in den Tropen lag".
In Klagenfurt wurde Albigs Novelle letztes Jahr als "gewöhnungsbedürftig" und gedanklich überfrachtet gerügt. Aber der Autor will nicht eine "etwas schrullige Perversion" schönreden oder zur Satire geradebiegen, sondern die Tragikomödie der Liebe in Zeiten von Tinder, Robotern und Androiden beschreiben. Dinge, sagt die kluge Kulturwissenschaftlerin Judith, "sind schlauer, als wir denken. Ihr Pech ist nur, dass sie nicht laufen können." In der Regel sind sie Kulturfolger, treu und gut: Wir brauchen sie, sie uns. Sie gehen dem Menschen zur Hand und erwarten dafür, gepflegt, geachtet, vielleicht sogar geliebt zu werden. Werden sie verspottet und vernachlässigt, rächen sie sich. Das ist der Deal, den Judith "Koevolution" nennt.
"Vergangenheiten liegen so fern, dass sie schon wieder an die Zukunft stoßen": Zukunft ist bei Albig meist Vergangenheit verkehrt herum, Utopie ein anderes Wort für Dystopie. In seinem Roman "Berlin Palace" recycelten in der nahen Zukunft smarte Chinesen Hakenkreuze, Rotkäppchen-Dirndl und andere Mythen deutscher Populärkultur lächelnd als Stil-Accessoires und lehren so die Flüchtlinge und Gastarbeiter aus Deutschland Mores. In "Ueberdog" kreierte Albig zuletzt den Underdog-Chic: Obdachlose als Trendsetter, Bag Style als letzter Schrei. Diesmal spielt Albig mit alten Mythen, Erzählkonventionen und kontrafaktischen Erinnerungen an das Konzept romantische Liebe.
Überall ist der "Rückbau" der DDR-Kultur im Gange. Gregor, Judith und ihr gemeinsamer Freund, der Plattenbau-Ingenieur und Le-Corbusier-Fan Bertram, sabotieren den Abriss ihrer geliebten Plattenbauten in der "Zone", indem sie nachts Bagger und Kräne abfackeln oder die Kulturbarbarei des IS in Palmyra als Fanal an die Häuserwände projizieren. Aber "Le Bertram" verrät die Sache des Platten-Bauhauses und verkauft sich an die Abrissfirma; Judith verlässt Gregor für den phantasielosen Museumsdirektor, der seinen Fossilienwart schon immer für verrückt hielt. Der, von allen Menschen und guten Geistern verlassen, verrennt sich immer weiter in seine kaum erwiderte Liebe zu Madeleine. Am Ende liegt Gregor hilflos wie ein Käfer auf dem Rücken, aber im Gegensatz zu seinem Namensvetter Gregor Samsa ist bei ihm der Chitinpanzer keine dauerhafte Versteinerung, sondern nur ein Gipsverband.
"Eine Liebe in der Steppe" ist keine leicht eingängige Parabel und für ein Gedankenspiel vielleicht ein bisschen zu lang. Aber es ist eine hübsch vertrackte, unterhaltsam erzählte Groteske über ein durchaus ernstes Thema: Die Vermenschlichung der Dinge geht einher mit der Verdinglichung des Menschen, der Rückbau der Vergangenheit führt zum Abriss aller Zukunft. Was, wenn sich die bunte Vielfalt der A-, Trans- und Neosexuellen weiter diversifiziert? Heute liebt man noch aufgelassene Kirchlein und fossile Kulturdenkmäler, morgen schnittige Prozessoren und schlaue Algorithmen, und übermorgen bleiben die Objekte mit ihrem erotischen Wispern und leidenschaftlichen Begehren vielleicht ganz unter sich.
MARTIN HALTER
Jörg-Uwe Albig:
"Eine Liebe in der Steppe". Novelle.
Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2017. 175 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
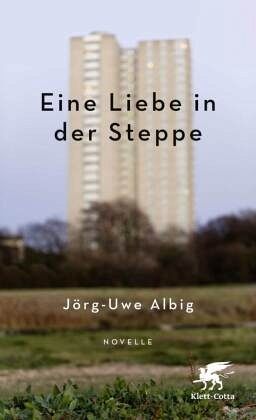





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.03.2018
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.03.2018