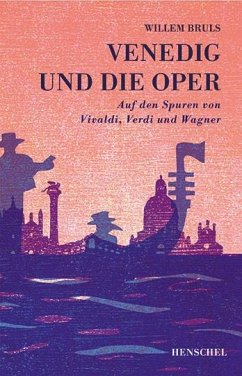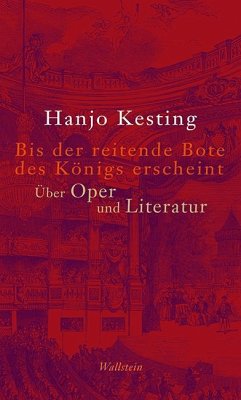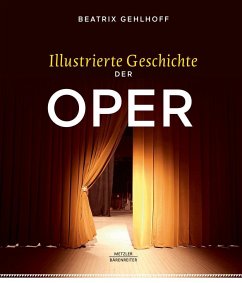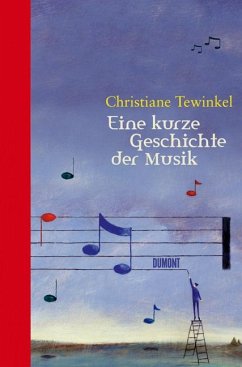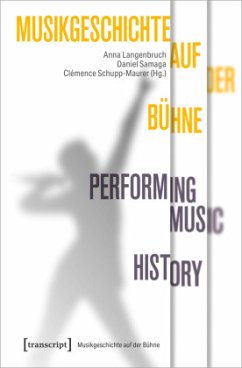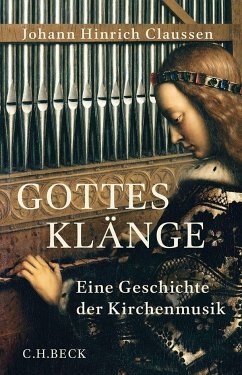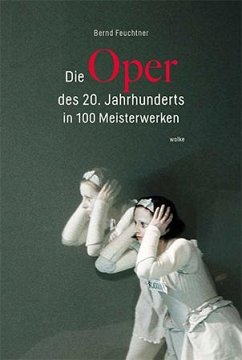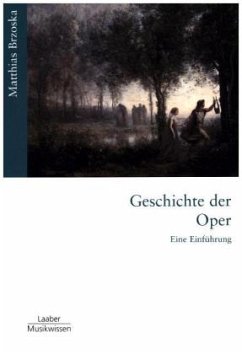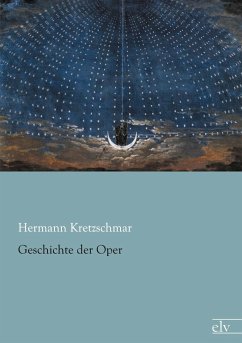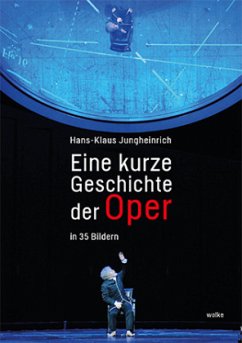musikwissenschaftlichen Buches, das ohne viel spezialistisches Vorwissen auskommt, zugleich jedoch intellektuellen Anspruch wahrt und über weite Strecken auch guten Kennern neue Einsichten (und selbst Vergnügen) bietet. Dass hier auf Notenbeispiele vollständig verzichtet wird, zeigt auch die Ausrichtung dieser Operngeschichte an, die sie von älteren, mittlerweile selten gewordenen Gesamtdarstellungen dieser Art grundlegend unterscheidet: In ihrem Zentrum steht die menschliche Stimme und die vielfachen Formen, in denen sie dramatisch eingesetzt wird.
Dementsprechend geben Abbate und Parker eine Definition der Oper, die auf den realismusfernen Charakter dieser Kunstform insistiert: "eine Spielart des Theaters, bei der die meisten (oder alle) Darsteller die meiste (oder die ganze) Zeit singen". Damit bringen die Autoren eine Schwierigkeit auf den Punkt, um die eine große Sängerin wie Maria Callas Bescheid wusste, wenn sie die Oper als so viel heikler als das Schauspiel einstufte: Das kontinuierliche Singen, jenen ästhetischen "Ausnahmezustand", auf der Bühne dem Publikum plausibel zu machen und vor dem Abgleiten ins Lächerliche zu schützen verlangt enorme Anstrengungen.
Auch die hohen finanziellen und emotionalen Einsätze, die mit dieser Kunstform seit jeher verbunden sind, vergessen die Autoren nicht. So führen sie das Aufkommen des Starwesens mit den Kastraten im achtzehnten Jahrhundert sowie das spannungsreiche Verhältnis zwischen Gesangsvirtuosen mit exorbitanten Gagen und weitaus weniger geschätzten Opernkomponisten am Beispiel Händels eindringlich vor. Wie schlecht der Ruf der Oper für manche kritische Beobachter in England war, versinnbildlicht Hogarths Kupferstich "Masquerades and Operas (or the Bad Taste of the Town)", wo Sängerstars und deren Mäzene in Gesellschaft von Teufeln und Hampelmännern dem Publikum imponieren, während die großen Werke der englischen Dramentradition als Altpapier in einer Schubkarre verscherbelt werden.
Die ästhetischen Einsätze der diversen Opernreformen, wie sie zur selben Zeit in Italien einsetzten und die sich in Frankreich in den Opern Rameaus und Glucks niederschlugen, werden ebenso anschaulich nachgezeichnet wie die damit einhergehenden Disziplinierungsversuche des Publikums. So hatten die Sänger vielfach nicht nur die geräuschvollen Bühnenmaschinen, sondern vor allem die lärmenden und lachenden Zuschauer zu übertönen, ein Zustand, der erst im Lauf des neunzehnten Jahrhunderts schrittweise eingedämmt wurde.
Eingebettet in diesen Hintergrund, gelingt es Abbate und Parker, die kanonischen Fixsterne des Repertoires (Mozart, Donizetti, Rossini, Verdi, Wagner, Puccini, R. Strauss) auf ungewöhnliche und oft originelle Weise zu befragen. Dabei liegen die Stärken ihrer Darstellung auf der umsichtigen Analyse des Einsatzes von Sprech- und Singstimme, von Mozarts "Entführung aus dem Serail" bis zu Schönbergs Melodram "Erwartung".
Vollständigkeit darf man bei einer derartigen Darstellung nicht erwarten, sondern vielmehr Akzentsetzungen auf bestimmte Operntraditionen und Komponisten. Angesichts der anhaltenden Glücklosigkeit ihrer bisherigen Rezeption wird man vielleicht die Opern Franz Schuberts weniger vermissen als eine ausführlichere Behandlung mancher Werke von Luigi Cherubini (etwa seiner "Médée") oder Halévys jahrzehntelang erfolgreiche und seit einiger Zeit wieder häufiger gespielte "La Juive" (1835). Immerhin wird das wirkmächtige Genre Grand opéra in einem eigenen Kapitel als Form anhand der Opern Meyerbeers behandelt und in der Folge in seinen Auswirkungen auf die Opern Verdis und Wagners diskutiert.
Sosehr die Darstellung der ersten 350 Jahre in ihrer Auffächerung von politischen, kulturellen und ästhetischen Dimensionen des Phänomens Oper besticht, so gespalten und etwas unbefriedigend wirkt das abschließende, der Zeit nach 1945 gewidmete Kapitel. Das Autorenduo konzediert zwar, das zwanzigste Jahrhundert sei das bisher reichste und komplexeste in der langen Geschichte der Gattung, doch habe sich diese letztlich in ein Totenhaus verwandelt, "ein wunderbares Totenhaus zwar mit spektakulären Aufführungen, aber eben in ein Totenhaus". Damit übernehmen Abbate und Parker letztlich die Einschätzung, die Vitalität der Oper läge seit einiger Zeit nur noch im Starkult und Eventtourismus der Opernindustrie. Neues und Eigenständiges könne somit nur durch die Vernichtung oder Unterdrückung des Alten entstehen, wie etwa die Sprengung der Opernhäuser, die Pierre Boulez 1967 schlagzeilenträchtig als radikale, allerdings unwahrscheinliche Lösung für das Dilemma der Avantgarde empfohlen hatte.
Die beiden Autoren fassen dies (etwas voreilig) zugleich als korrekte Zeitdiagnose wie als Beleg für die geringe Repertoiretauglichkeit der in den letzten Jahrzehnten uraufgeführten Opern auf. Dementsprechend widmen sie allein Benjamin Britten als einzigem Nachkriegskomponisten größeren Raum, während Hans Werner Henze, Luciano Berio, Olivier Messiaen, György Ligeti, John Adams oder Thomas Adès nur sehr kursorisch abgehandelt werden. Dies mag konservativ anmuten, doch ist es angesichts des hier gewählten Zugangs, der die Oper primär als Aufführungskunst begreift, durchaus konsequent. Am Ende der Operngeschichte von Abbate und Parker steht somit ein Resümee, das seine Hoffnung nicht so sehr auf künftige Komponisten und neue Werke, sondern ganz auf das möglichst lange Weiterleben einer historisch gewachsenen Stimm- und Aufführungskultur setzt.
ANDREAS MAYER.
Carolyn Abbate/ Roger Parker: "Eine Geschichte der Oper". Die letzten 400 Jahre.
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Siber und Nikolaus de Palézieux. Verlag C. H. Beck, München 2013. 735 S., Abb., geb., 38,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
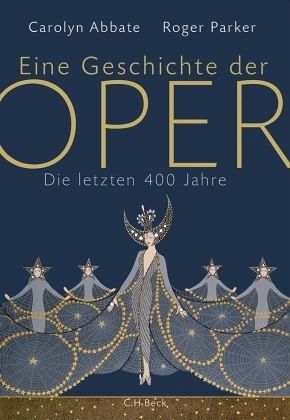






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.10.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.10.2013