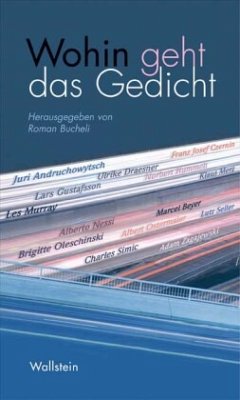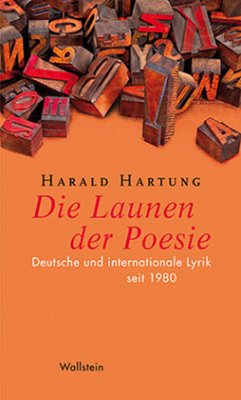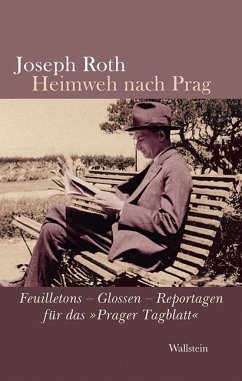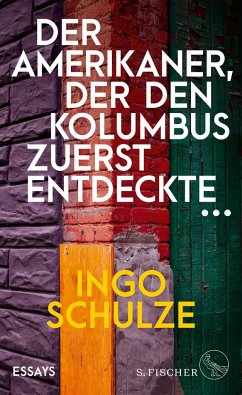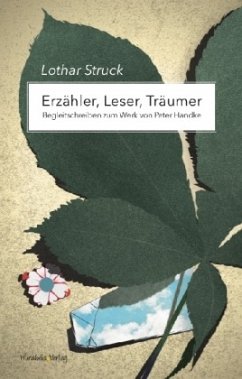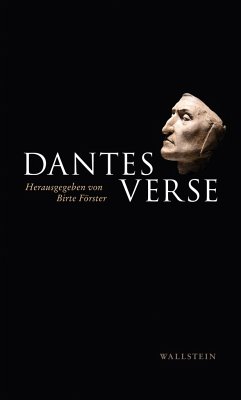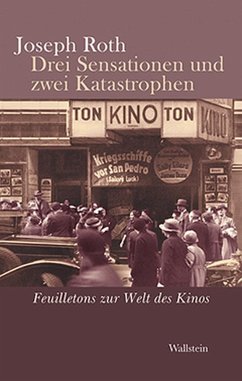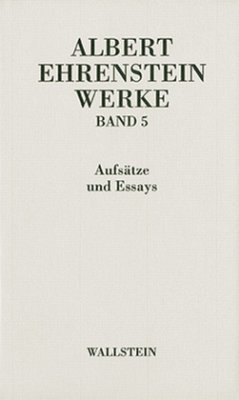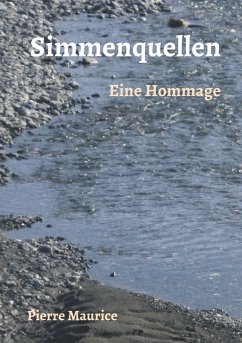deutschsprachigen Lyrik anders und neu. Was früher als elegant vermittelte Gelehrsamkeit wahrgenommen wurde, zeigt nun seinen doppelten Boden. Indem der Kenner Hartung über Poesie und Poetik schreibt, in leichthändig geschriebenen Studien von unaufdringlicher Belesenheit, gibt der Dichter Einblick in seine eigene lyrische Werkstatt.
Eine Werkstatt im Wortsinne ist es, was Hartung an die Stelle ekstatischer Entrückungen oder gefühliger Innerlichkeit setzt. Meisterschaft ist für diesen Meister das Ergebnis eines Handwerks - in jenem Sinne des Wortes, den sein programmatischer Essay im "Merkur" 1999 proklamierte und der mittlerweile fast schon redensartlich geworden ist. Dabei stammt die Beschreibung der Lyrik als einer "Sache der Hände" aus einem Brief Paul Celans an Hans Bender: "Und diese Hände wiederum gehören nur einem Menschen. Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte." Hartungs Essay über Hände und Handwerk steht am Anfang der fünfzehn Essays zur deutschen Lyrik von Goethe bis Gernhardt, die sein neuer Band versammelt. "Was waren das für Zeiten, in denen das Handwerk noch geholfen hat?", fragt er scheinheilig und verweist zur Antwort auf jene Widmung, die T. S. Eliot dem "Waste Land" vorangestellt hat: "For Ezra Pound, il miglior fabbro".
Hartungs Werkstattberichte und -besichtigungen rücken Gedichte von Goethe bis zu Celan dergestalt in neue Perspektiven, dass dem Kenner überraschende Einsichten eröffnet und zugleich doch neugierigen Neulingen vergnügliche Einführungen geboten werden. Gerade weil er mit Vorliebe mit Beobachtungen zu handwerklichen Fragen beginnt, bleiben seine Analysen auch dort sinnlich konkret und sensibel, wo es in die Höhenlagen ästhetischer Theorie hinaufgeht. So findet er in Goethes "Venezianischen Epigrammen", die oft gegen die vermeintlich erlebnistrunkenen "Römischen Elegien" ausgespielt worden sind, eine Poetik des schöpferisch bewältigten Ennui, die den Rang dieser Texte neu bestimmt: eine so energische wie erfolgreiche "Inthronisation der Langeweile als Musenmutter".
So führt ein Essay unter dem bescheidenen Titel "Über einige Motive der Droste" gerade deshalb an jenen Punkt, an dem sich in den Dichtungen "halluzinatorisch die Tiefe der Zeit öffnet", weil er mit der scheinbar bloß technischen Neugier auf wiederkehrende Nebenmotive einsetzt. So spürt er dem diskreten Umgang mit Odenmaßen in der Poesie des zwanzigsten Jahrhunderts nach, bei Georg Britting und Ludwig Greve, und beantwortet wie nebenbei die Frage, wie die produktive Auseinandersetzung mit derartigen Formtraditionen möglich sein könnte, ohne in blasse Epigonalität zu verfallen.
Mit derselben Aufmerksamkeit entdeckt er am anderen Ende des Spektrums, in der neusachlichen Poesie des glanzvoll als "Virtuose des Mittleren" verteidigten Erich Kästner, eine in die industrialisierte Metropole verschlagene Naturlyrik. Und in den programmatisch formstreng-konservativen Versen Adelbert von Chamissos spürt er die Augenblicke jener "offenen Disparatheit" auf, in denen sich die beunruhigende Moderne wie ein Abgrund öffnet. Bis zu Ernst Meister und Günter Kunert spannt sich der Bogen, zu Robert Schindel und, als Überraschungsgast, Alfred Brendel.
Die Vorzüge dieser nüchternen, sachlichen und ebendarum so sensiblen Wahrnehmung zeigen sich am deutlichsten dort, wo sie sich auf die, mit Brecht zu reden, "pontifikale Linie" der modernen Poesie richtet. Ein nur wenige Seiten umfassender Essay über Paul Celan befasst sich mit dessen Studien zur Farbgebung bei Georg Trakl, weiter nichts. Weiter nichts? Wer unter Hartungs Anleitung verfolgt, wie der Nachfahre den Umgang des Vorgängers mit der Kombination von Farbadjektiven studiert, bekommt zu sehen, was so vielen umstandslos ins Metaphysische gehenden Celan-Studien entgeht: wie hier ein Poet als neugieriger Philologe sein lyrisches Hand-Werk betreibt, wie er seine Hände "wahr" machen will. Überzeugender als in dieser dichten Fallstudie könnte Hartungs Plädoyer für die Poesie als "Sache der Hände" kaum begründet werden.
Und in ebendieses Plädoyer mündet der Band nach dem weiten Bogen durch zwei Jahrhunderte am Ende wieder ein: in Bemerkungen "Über einige Erfahrungen beim Schreiben von Lyrik", Erinnerungen an die eigenen lyrischen Anfänge, Bekenntnisse zu Lieblingsdichtern wie Ungaretti und Christensen. Nun in erklärtermaßen ganz eigener Sache formuliert Hartung die leidenschaftliche Verteidigung einer Poesie, deren von Celan proklamierte "Wahrheit" sich durch "wahre Hände" artikuliert, als genaue Form - in unauffälligen metrischen Regulierungen beispielsweise, die kein Leser bemerken muss und die doch dem Autor jene produktive "Erschwerung der Form" auferlegen, in der die russischen Formalisten einst einen Fundamentalsatz aller Poesie erkannt haben.
Das, was Valéry die "errechneten Verse" genannt hat, entfaltet in diesem Werkstattbericht einen ganz eigenen poetischen Glanz, in der ironischen Aneignung der Sonettform ebenso wie in Inger Christensens Spiel mit mathematischen Prinzipien oder in jenen silbenzählenden Verfahren, die Hartungs eigene Poetik mit derjenigen W. H. Audens verbindet. "Dem Romanautor", bemerkt Hartung, "verübelt niemand, dass er von Thema, Plot und Hauptfiguren redet, allein der Lyriker soll noch immer singen, wie der Vogel singt. Selbst Kritiker misstrauen der poetologischen Reflexion, sie hätten sonst nicht das Wort ,Kopflastigkeit' erfunden." Ob es freilich auf Last oder Lust hinausläuft, das hängt ganz vom Kopf ab. Liest man die Essays dieses miglior fabbro, so stellt sich ein, was der Buchtitel ohne Übertreibung verspricht: "Ein Unterton von Glück".
HEINRICH DETERING
Harald Hartung: "Ein Unterton von Glück". Über Dichter und Gedichte. Wallstein Verlag, Göttingen 2007. 160 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
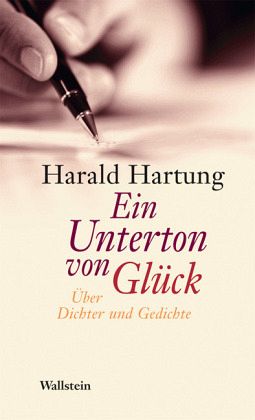




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.01.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.01.2008