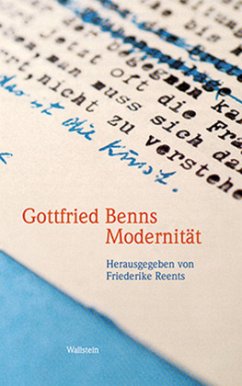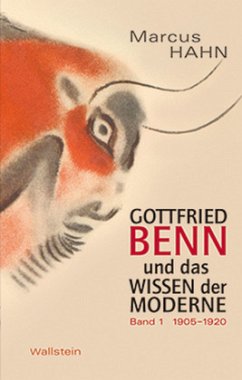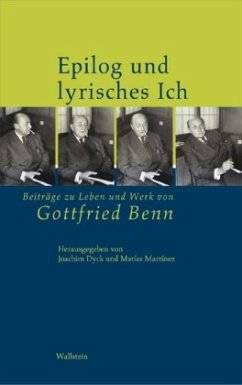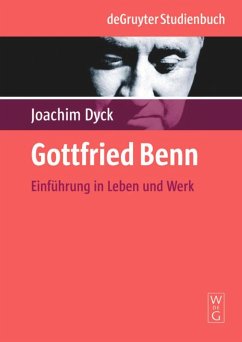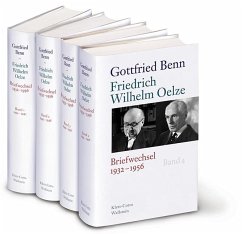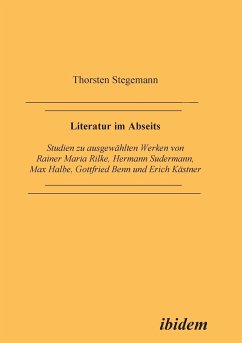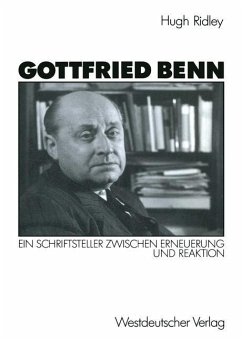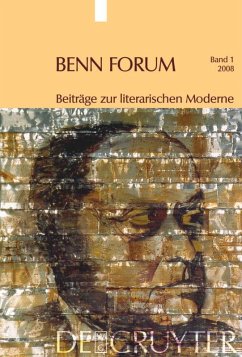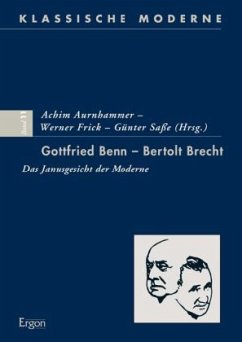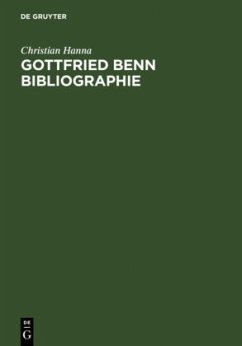Globus dahin. Seine Ideenflucht führt den Privatdozenten in die Imperien der mediterranen Antike, um sich dann mit den Beduinen, den Völkerschaften der Inka und auf Tahiti zu beschäftigen, Dschungel und Wüsten durchstreifend. Wie nebenbei fallen despektierliche Bemerkungen zu prominenten Geistesgrößen wie Heraklit, Spinoza, Kant und Einstein; von ihnen wird nichts bleiben als der Wandel selbst, der Fluss aller Dinge.
Wer den gelehrten Assoziationen und ästhetischen Schlüsselreizen folgt, die Gottfried Benn in dem kurzen Prosatext "Der Garten von Arles" versammelt, muss unweigerlich vermuten, dass nach diesen delirierenden Eskapaden das Kolleg des kommenden Tags mit keinem vorzeigbaren Resultat wird aufwarten können. Wie auch sollte aus den wirren Stichworten eine Vorlesung werden? Vor dem geistigen Auge probt der Dozent schon den kühnen Offenbarungseid. "Meine Herren, muss ich sagen, Sie sind einem ganz subtilen Schwindel zum Opfer gefallen."
Gerade als scheiternder Vortrag, so ahnt man, sind die geistigen Ausschweifungen des Gelehrten bei seiner Spurensuche nach den Wurzeln des abendländischen Ich eine Art Lehrveranstaltung, weil sie unfreiwillig vorführen, wovon sie handeln. Mit dem kleinen Prosatext zielte Benn ins Große, auf jenes, so wörtlich, "Schlachtfeld des Sinns", auf dem sich die Wort- und Sprachkunst unter den Bedingungen einer naturwissenschaftlich-technischen Moderne zu behaupten hatte. Dass es sich bei Gottfried Benns 1920 erstmals erschienener Etüde zu den Gedankenströmen eines Geistesmenschen um einen strategischen "Schlüsseltext" nicht nur dieses Schriftstellers, sondern der literarischen Moderne überhaupt handelt, ist eine Einsicht der minutiösen Studie von Friederike Reents.
Die Autorin nimmt sich einen Prosatext von gerade einmal zehn Seiten Umfang vor, der bislang zwar nicht unbeachtet geblieben ist, aber in eher summarischer Weise abgehandelt wurde, mal als Indiz für Benns Hinwendung vom Erzählen zur Essayistik, mal als stilistisches Exempel der "Desozialisierung" des Autors nach dem Ersten Weltkrieg. Zu den politisierenden Einordnungen Benns hält Reents ebenso Distanz wie gegenüber der gängigen Einteilung in klare Werkphasen.
Ordnung und Einteilung, so belehrt die Lektüre des "Gartens", sind ihrerseits oft genug die Instrumente einer von sich selbst berauschten Herrschaftsattitüde. "Man kann die ganze Menschheit einteilen in deskriptiv oder metaphysisch Gerichtete", bringt Benns Philosophieprofessor mit den ersten Worten großspurig zu Papier. Die Interpretin dieser Sätze optiert methodisch für das Gegenteil. Sie stellt Verknüpfungen her, zieht von einzelnen Worten, Motiven, rhetorischen Figuren des "Gartens" prägnante Linien in Benns früheres und folgendes Werk, um so das bei isolierter Lektüre opak Bleibende zu entschlüsseln.
Nur ein Beispiel dieses Verfahrens ist die Analyse der Wendung "hyperämische Metaphysik". In diese seltsame Formel fasst der Philosoph, was er seinen Studenten als Beschreibung der geistigen Lage der Zeit zu offerieren hat. Der medizinische Terminus für Blutfülle, Hyperämie, tritt in Benns Lyrik und Essayistik mehrfach als eine poetische Chiffre auf. Im Gedicht "Der Sänger" werden "fahle Hyperämien" mittels "Koffein" erzeugt. Benns poetischer Montagestil lässt dabei die durch das Farbadjektiv evozierte "Blutleere" mit ihrem Gegenteil, einem medizinisch konstatierten "Blutandrang", zusammentreffen. In solchen Mikrobefunden, so Reents, verwirklicht sich das "Zersprengen" logischer Gegensätze als Inbegriff Bennscher Poetik. Mit dem Leitwort der Hyperämie verbindet Benn den rauschhaft herbeigeführten "Entzündungs- oder Wallungszustand" als einen künstlerischen Existenzmodus, in welchem die "Trennung von Welt und Ich" aufgehoben erscheint. Wo Metaphysik waltet, haben die kleinen Helfer sie herbeigezaubert. "Was heutzutage Gott ist: überall wo Tablette ist oder die Originalstaude mit Pottasche für den Coquero", heißt es in der Erstfassung des "Gartens". Zu Benns Rausch-Obsessionen und seinen nicht minder forcierten, steilen Thesen bildet Reents' geradezu spröde Detailgenauigkeit den denkbar produktiven Kontrapunkt. Ihr Buch ist, in der klugen Beschränkung auf die genuin philologischen Erkenntnismittel des dichten Lesens, provozierend langsam und gründlich.
Die um van Goghs Künstler-Wahnsinn kreisenden Farb- und Raumphantasien des "Gartens" bilden für Reents ein Manifest eigener Art. Denn mit jenen Passagen, in welchen der Dichter etwa die Farbwirbel zweier Sonnen über Zypressen und Kornfeldern feiert, bricht in seinem Sprachduktus das Lyrische durch. Über ganze Absätze gerät Benns Prosa in ihrer das Syntaktische auflösenden Deklamation zu einer Zeugungsphantasie des Poetischen. "Aus Antithesen-Spalt, aus Monistisch-Aufgesprungenem": So müsste gedichtet werden, so würde ein neues Künstlertum die Aporien des modernen Ich beantworten. Hinterrücks, vom eigenen Assoziationsstrom mitgerissen, hat sich die Schreibkrise eines philosophierenden Privatdozenten in die Rauschküche des Sprachkünstlers verwandelt. Dem Materialfetischisten Benn beim Experimentieren auf die Finger zu sehen bedeutet ein Erkenntnisglück, zu dem die Strenge des Kommentars das Ihre beiträgt.
ALEXANDER HONOLD
Friederike Reents: "Ein Schauern in den Hirnen". Gottfried Benns "Garten von Arles" als Paradigma der Moderne. Wallstein Verlag, Göttingen 2009. 448 S., br., 49,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
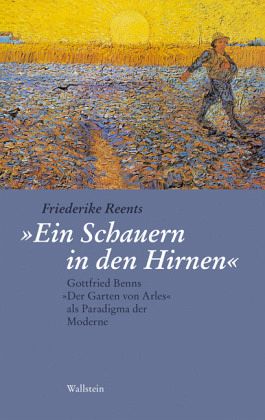




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.04.2010
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.04.2010