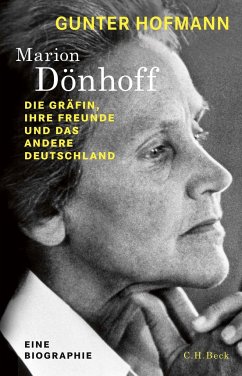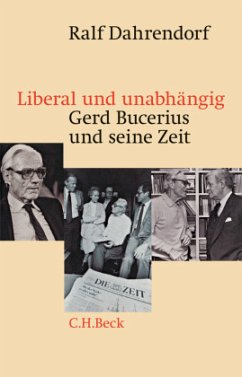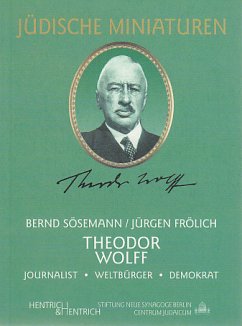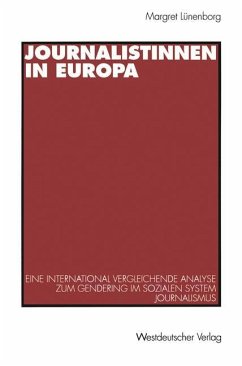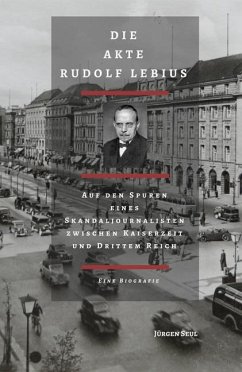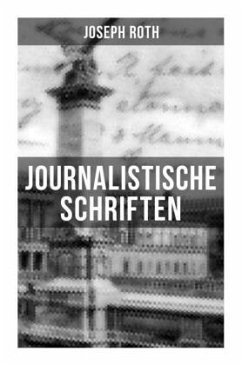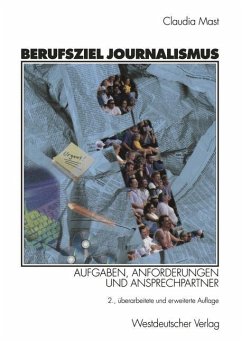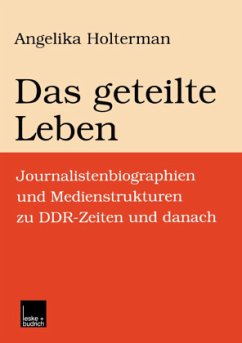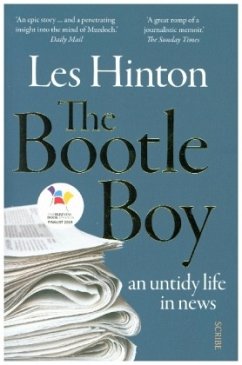Fieber- und Entzündungserkrankungen ohnehin gerade zu einem Urlaub im Süden geraten, worauf sie in einem Brief an eine Freundin ihr Entsetzen über die "in Aussicht genommene Faulenzerei" ausdrückte.
Trotzdem fiel der Rat nicht nur der besorgten Mutter, sondern auch seitens wohlmeinender Freunde über die Jahre hinweg geradezu monoton aus: Paul Scheffer, ihr Freund und Mentor beim "Berliner Tageblatt", schrieb ihr im November 1936 nach Rom, wo sie sich gerade für zwei Monate im Auftrag der Zeitung aufhielt, sie möge dort "moderiert-faul" agieren und "um keinen Preis pflichttreu" sein. Im März 1939 empfahl wiederum ihr Arzt einen "geruhigen Lebenswandel", worauf Margret Boveri sich in die "Langweiligkeit der neutralen Länder" schickte und eine Korrespondenz für die "Frankfurter Zeitung" in Stockholm annahm. Doch selbst dort noch erreichte sie ein Jahr später das mahnende Schreiben ihres Frankfurter Redaktionskollegen Paul Sethe: "Ich möchte, daß Sie mehr Stunden als bisher dafür finden, mit skandinavischen Bekannten, törichten und wissenden, gleichgültigen und sympathischen, zu plaudern, durch die Straßen zu schlendern, ins Theater zu gehen und in Gottes Namen auch einmal eine Stunde im Kaffee zu verdösen."
Margret Boveri war nicht die Frau für so etwas, denn sie war kein Wunderkind gewesen. Niemand hatte ihr gesagt, wie man Journalist wird, alles war selbst - und hart - erarbeitet. Sethe hatte seinen Aufruf zum Müßiggang auch durchaus mit dem Hintergedanken nach Stockholm gesandt, daß seine Korrespondentin dadurch mehr Stimmungsberichte aus dem im Krieg neutral verbliebenen Schweden hätte schreiben können. Aber Margret Boveri litt geradezu körperlich unter ebendieser Neutralität. Es trieb sie weg, aus beruflichen Gründen - weil sie als Journalistin nicht abseits des Weltgeschehens stehen wollte - und aus privaten, denn Scheffer, den sie auch nach ihrem Weggang vom "Berliner Tageblatt" als Ratgeber schätzte, war mittlerweile als Berichterstatter in die Vereinigten Staaten entsandt worden. Welcher Art die Faszination der mittlerweile vierzigjährigen Boveri für den siebzehn Jahre älteren Kollegen genau war, ist unbekannt, doch beider von 1934 bis zu Scheffers Tod 1963 ununterbrochene Korrespondenz enthält einige Formulierungen, die spüren lassen, daß die Zuneigung Boveris für Scheffer etwas unheimlich war.
Die Erschließung dieser rund siebenhundert Briefe umfassenden Korrespondenz ist das Herzstück der Biographie "Ein deutsches Leben", die die Berliner Historikerin Heike B. Görtemaker der Berliner Journalistin Margret Boveri widmet. Ja, das war sie vor allem: eine Berliner Journalistin, obwohl ihr Gebiet die Außenpolitik war und sie 1900 fern von Berlin, in Würzburg, als Tochter des namhaften Zoologen Theodor Boveri geboren wurde.
Ihr Weg nach Berlin nahm Umwege. Akribisch zeichnet die Biographie den Lebenspfad der Weimarer Zeit nach: von der eher beiläufigen Mitgliedschaft im völkisch geprägten Deutsch-Nationalen Jugendbund über die Enttäuschung der Inflationszeit, als das vom schon 1915 verstorbenen Vater im brüderlichen Großunternehmen Brown, Boveri & Cie. angelegte Kapital verlorenging, bis zur Desillusionierung im bayrischen Schuldienst als Referendarin nach dem Lehramtsstudium. Eins wird klar: Margret Boveri hatte keinen Grund, der Republik mit großer Sympathie zu begegnen. Ihre Bereitschaft, sich später den Bedingungen eines Lebens im Nationalsozialismus zu fügen, entstand aber auch aus der patriotischen Abgrenzung gegen die amerikanische Mutter, die Deutschland 1926 den Rücken gekehrt hatte, um in den Vereinigten Staaten ihre wissenschaftliche Karriere fortzuführen. Hier liest sich Heike Görtemakers Buch wie ein Kommentar zur aktuellen Debatte um die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf. Marcella Boveri ist dieser Spagat nicht geglückt. Ihre Tochter hat ihn gar nicht erst versucht.
Es war auch so nicht leicht für eine Frau, die damals Journalistin werden wollte. Der Plan ihrer Romreise für das "Berliner Tageblatt" etwa traf auf Widerstand in der Redaktion. Scheffer erläuterte ihn ihr in einem Brief und versicherte, daß es eigentlich keinen Grund für die Ablehnung gebe, "außer der Entscheidung der Natur".
Doch die negierte Margret Boveri konsequent. Sie arbeitete härter als ihre männlichen Kollegen. 1930 hatte sie endlich ihren eigenen Weg gefunden: in Berlin, wo sie - ein Skandal in der damaligen Zeit - mit dem verheirateten schwarzen Amerikaner Ernest Everett Just zusammenlebte, der als Zoologe in Deutschland forschte. Doch Berlin sah auch das schnelle Scheitern dieser Beziehung und die mühevollen ersten Schritte in die Welt der Publizistik. Die Anstellung beim "Berliner Tageblatt" im August 1934 etablierte Margret Boveri dann aus dem Nichts heraus an der Spitze des deutschen Journalismus, denn das traditionell liberale Blatt wurde wie die "Frankfurter Zeitung" von den Nazis als publizistisches Aushängeschild Deutschlands geduldet und ließ ein unabhängigeres Arbeiten als in den meisten anderen Redaktionen zu. Dennoch war man in der Berichterstattung alles andere als frei, wie Margret Boveri mehr als dreißig Jahre danach in ihrem Buch "Wir lügen alle" berichtet hat.
Deshalb war es eine Befreiung, als sie erst vom "Tageblatt" und später von ihrem nächsten Arbeitgeber, der "Frankfurter Zeitung", auf Auslandsreisen geschickt wurde. Sie lieferten ihr den Stoff für ihre vielbeachteten Bücher über den Mittelmeerraum und Vorderasien, die zwischen 1936 und 1939 erschienen. Die Margret Boveri jener Zeit war eine ruhelose Frau, die ihre engsten Beziehungen mit den rasch wechselnden Automobilen unterhielt, die sie auf Namen wie "Mathis", "Bungo" oder "Lettus" taufte. Auf ihren Grabstein, so schrieb sie 1943, könne man setzen: "Sie liebte rohes Fleisch und Chauffieren."
Als sie das notierte, war Margret Boveri in Lissabon im Einsatz, wohin es sie verschlagen hatte, nachdem sie 1940 doch noch als Korrespondentin in die Vereinigten Staaten entsandt, dort aber nach dem amerikanischen Kriegseintritt interniert und schließlich nach Portugal abgeschoben worden war. In Lissabon gab es noch Zeitungen aus den alliierten Feindstaaten zu lesen, und auf der Grundlage von deren Berichten stellte Margret Boveri wiederum eigene Artikel für die "Frankfurter Zeitung" zusammen. Aber das Blatt wurde Ende August 1943 geschlossen, weil nun auch der letzte Rest an freier Berichterstattung in Deutschland nicht mehr toleriert wurde, und die Redaktionsmitglieder wurden auf regimetreue Zeitungen verteilt. Margret Boveri kam bei der neugegründeten Wochenzeitung "Das Reich" unter und siedelte endgültig nach Berlin um.
Hier blieb sie bis zu ihrem Tod 1975. Sie blieb dort während der Bombenangriffe, des Einmarschs der Russen und später der Blockade. Sie sah es als Ehrenpflicht an, im Zentrum des Sturms auszuharren und darüber Zeugnis abzulegen, was sie im Frühjahr 1945 in einem mehr als hundertseitigen Bericht über die Eroberung der Stadt tat, den sie sorgsam verbarg und erst für die Zeit nach ihrem Tod für eine Publikation vorsah. Er sollte aber schließlich die Basis werden für ihr Erinnerungsbuch "Tage des Überlebens", das 1968 erschien.
In Berlin saß sie an der Nahtstelle des Kalten Kriegs, und die Teilung von Stadt und Land war die Wunde, die sich in Margret Boveri nicht mehr schloß. Durch ihren Ruhm als Außenpolitikexpertin, der selbst in den letzten beiden Kriegsjahren, als ihr keine unabhängige Berichterstattung mehr möglich war, intakt geblieben war, fand sie schnell neue Publikationsforen in der jungen Presselandschaft, darunter auch in dieser Zeitung, wo es mit Erich Welter und Karl Korn gleich zwei Kollegen in verantwortlicher Position gab, mit denen Margret Boveri schon zuvor zusammengearbeitet hatte. Doch sie weigerte sich, auch nur das kleinste Zugeständnis an Adenauers Politik der Westbindung zu machen, und war deshalb vor allem im Feuilleton vertreten. Ihre politischen Kommentare erschienen meist in der Monatszeitschrift "Merkur".
"Die Bundesrepublik hätte nie entstehen sollen", schrieb sie 1953 an Paul Scheffer. Sie verteidigte das Erbe des Deutschen Reichs als eines ständestaatlichen statt demokratischen Landes, weil das ihrem Elitebild entsprach. Mit der zweiten deutschen Republik arrangierte sie sich erst, als die Ostpolitik Willy Brandts vollzog, was sie immer gefordert hatte: die Annäherung an den Warschauer Pakt, um Deutschlands Einheit zu erreichen. Dennoch blieb sie eine publizistische Stimme, die im Konzert der bundesdeutschen Mehrheitsmeinung gerne ihren Sondersang erschallen ließ. Diese Rolle kommt in Heike Görtemakers Buch etwas zu kurz, das sich vor allem auf die Zeit des "Dritten Reichs" konzentriert. Verkaufsstrategisch ist das zu verstehen, aber man hätte sich mehr gewünscht - gerade weil es sich nicht nur um ein materialreiches, sondern auch um ein blendend formuliertes Buch handelt, das erkennbar von der Schulung der Autorin an Margret Boveris journalistischen Arbeiten profitiert hat.
Doch selbst diese lebendige Darstellung läßt eines weiter im unklaren: den Charakter der Dargestellten selbst, denn Margret Boveri stellte in ihrer Korrespondenz stets die Erlebnisse als Journalistin in den Mittelpunkt; private Bemerkungen finden sich selten. Nicht umsonst versandte sie seit ihrer Anstellung beim "Berliner Tageblatt" sogenannte "Rundbriefe" an ihre Freunde, die sich verpflichten mußten, diese Mitteilungen nach Anfertigung einer Abschrift wieder an Margret Boveri zurückzusenden, damit die Verfasserin sie weiter versenden und schließlich - noch wichtiger - archivieren konnte. Nicht nur der Natur hatte sie deren Entscheidung nicht überlassen wollen, auch sonst sollten alle sich ihren Entscheidungen fügen. Die Biographie zeigt Margret Boveri als eine Wunderfrau eigenen Rechts.
ANDREAS PLATTHAUS
Heike B. Görtemaker: "Ein deutsches Leben". Die Geschichte der Margret Boveri. Verlag C. H. Beck, München 2005. 416 S., 18 Abb., geb., 26,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
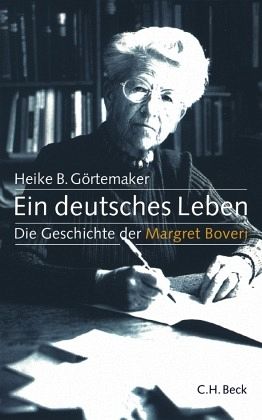






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.02.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.02.2005