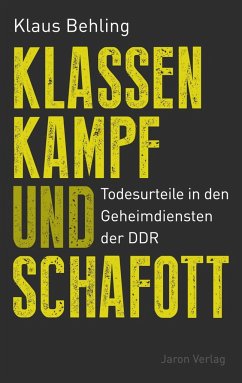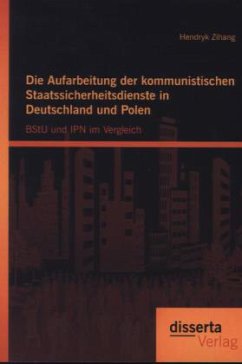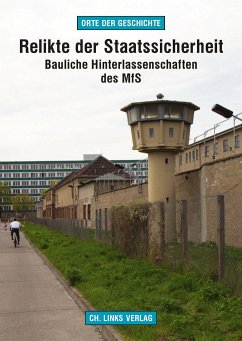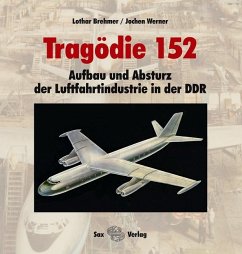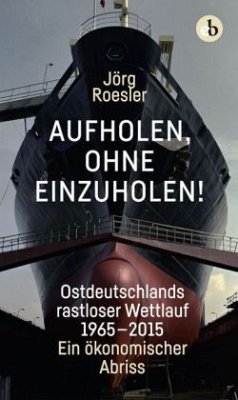werfen, die insbesondere die Stasi über die Alpenrepublik mit westlichen Partnern tätigte. Dabei ging es manchmal um Spionage, meist aber um Technologieschmuggel, für den die Drehscheibe Schweiz äußerst nützlich war. Denn der Westen hatte sich darauf verständigt, zahlreiche für die Rüstungsindustrie relevante Produkte nicht in den Osten zu liefern, und diese in der "Cocom"-Liste erfasst. Die Schweiz hatte sich zwar verpflichtet, die "Cocom"-Regeln anzuwenden; gleichwohl war es möglich, sensitive Produkte aus dem Ausland zu importieren und dann wieder zu exportieren - auch nach Moskau und Ost-Berlin. Diese Möglichkeiten wurden auf westlichen Druck zwar mehr und mehr eingeschränkt; vollständig konnte die "Schleuse Schweiz" jedoch nie geschlossen werden.
Das Buch besteht fast ausschließlich aus locker aneinandergereihten, auf jeweils einer Personenfiche basierenden Geschichte. Da geht es etwa um den "Techno-Banditen Nr. 1", den Kaufmann Richard Müller, der sich auf Technologieschmuggel mit dem Osten spezialisierte. Obwohl dessen Tätigkeit in der Schweiz bekannt wurde, erhielt er dort zeitweilig eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung. Um sich nach einem später auffliegenden Computerdeal der Strafverfolgung zu entziehen, begab er sich in den Osten, wo ihn die Stasi mit einer neuen Identität ausstattete, unter der er weiter in der Schweiz Geschäfte machte. Schließlich kehrte er doch in die Bundesrepublik zurück, wo er sich den Behörden stellte und sich einem Prozess aussetzte, in dem er offensichtlich aufgrund seines Geständnisses nur zu einer Bewährungsstrafe und zur Zahlung von fünf Millionen D-Mark Bußgeld verurteilt wurde.
Einmal rückte sogar DDR-Außenhandelsminister Gerhard Beil ins Fadenkreuz der Schweizer Bundespolizei. Beim "Auffliegen" eines Spionagefalles in der Schweiz waren die Ermittler auf ein Nummernkonto gestoßen, das - wie sich später herausstellte - 1969 im Auftrag von Beil eröffnet worden war. Es diente offensichtlich der Kommunistischen Partei Österreichs zur Abwicklung ihrer Geschäfte. Der Treuhänder, der das Konto eröffnet hatte, packte 1979 gegenüber der Schweizer Bundespolizei aus. Eine Einreisesperre für Beil wurde zwar erwogen, aber nicht umgesetzt: Der Vorgang wurde wohl "aus Gründen des volkswirtschaftlichen Allgemeinwohls zu den Akten gelegt".
Des Weiteren erfährt man, dass die Schweiz eines der wenigen westlichen Länder war, in denen die DDR einen Militärattaché hatte. Dieser unterhielt einen relativ großen Apparat, der allerdings vom ostdeutschen Militärgeheimdienst mit nachrichtendienstlichen Aufgaben betraut wurde. Zufällig fiel dem Schweizer Geheimdienst der Fahrer des Attachés in die Hände, der sich "umdrehen" ließ und fortan für die Schweizer Seite berichtete, auch aus Ost-Berlin und von der Wiener Konferenz für konventionelle Abrüstung in Europa. Er flog jedoch auf, wurde 1985 verhaftet und 1987 von einem Militärgericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Zuge der friedlichen Revolution kam er Ende 1989 jedoch wieder frei.
Ein Gesamtbild entsteht aus solchen Einzelfällen nicht. Das scheint aber auch nicht das Hauptziel des Autors zu sein. Obwohl er vollmundig schreibt, dass er "neue Perspektiven bei der Aufarbeitung von DDR-Geschichte" eröffnen wolle, geht es ihm eher um eine wohlfeile Abrechnung mit den Schweizer Staatsschutzbehörden. Geprägt "von einem tief sitzenden, geradezu manischen Antikommunismus" sowie von "einem Antiliberalismus", hätten sie durch ihre bereitwillige Kooperation mit westlichen Nachrichtendiensten de facto die Neutralität ihres Landes verletzt, ihre Ermittlungen seien "selten effizient" gewesen und sie seien äußerst bereitwillig von Bürgern, Behörden und Banken - auch durch unbürokratische "Kontenlüftung" - unterstützt worden.
Die Schweizer Akten widersprächen letztlich dem "Schreckensbild einer militärischen und politischen Bedrohung des Landes durch den Ostblock" - gerade die DDR habe sich bei Spionage stark zurückgehalten. Denn letztlich sei der Ostblock an einer Erhaltung der Schweizer Neutralität sehr interessiert gewesen: Die Schweiz war für diesen äußerst nützlich "als Basis und Rückzugsraum für eigene Agenten, als diskreter Verhandlungsort mit dem politischen Gegner, als sicherer Hafen für eigene Vermögenswerte sowie als Marktplatz für legale und illegale Geschäfte". Das dürfte wohl zutreffen - aber war das nicht Grund genug für die Schweiz, ein wachsames Auge auf diese Aktivitäten zu haben und sich dafür um Unterstützung von den westlichen Diensten zu bemühen?
HERMANN WENTKER
Andreas Förster: Eidgenossen contra Genossen. Wie der Schweizer Nachrichtendienst DDR-Händler und Stasi-Agenten überwachte. Ch. Links Verlag, Berlin 2016. 224 S., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
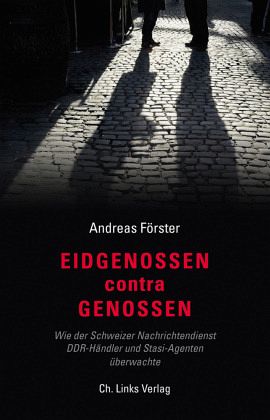





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.12.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.12.2016