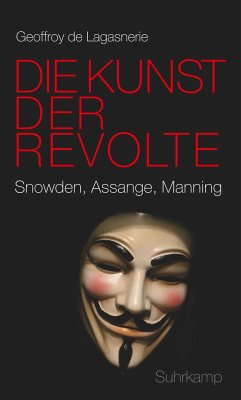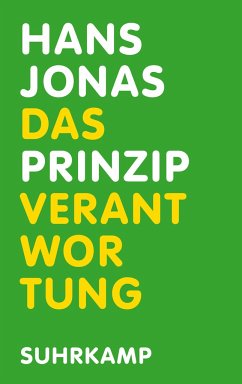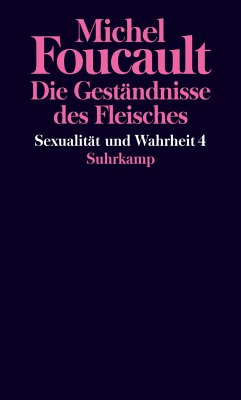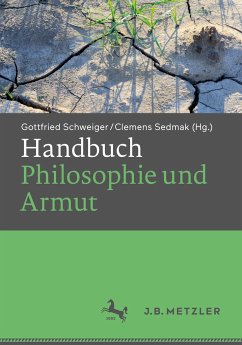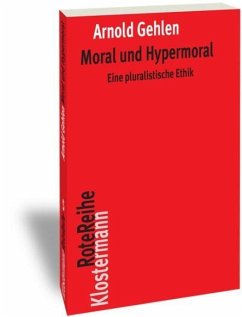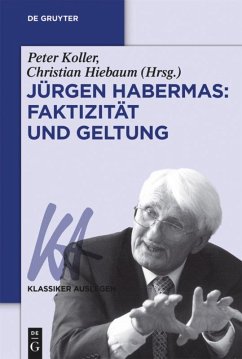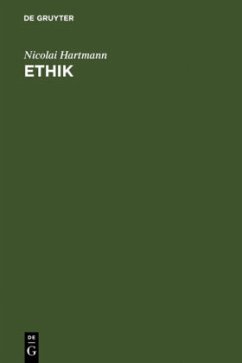einem auftaucht, und dann zieht sie all jene mit sich, die sich davon Sinn und Erfüllung durch Erkenntnis und Handeln versprechen.
So ein Gedanke, mit dem und in dem sich leben lässt, so cool, smart und rational, wie zu werden und zu sein einem in den Zentren der reichen Nationen zugefallen ist und gefällt, ist der effektive Altruismus.
Fünf Jahrzehnte brauchte das jugendliche moralische Bewusstsein im wissenschaftlich-technischen Westen, um sich vom Wortschatz und vom Altruismus der Revolutionen zu lösen und sich auf die neuen Ressourcen und Möglichkeiten zu besinnen: Informationen sammeln, Geld verdienen, Netzwerke einrichten, mit denen den Armen weltweit besser zu helfen sein könnte als mit der Kritik der politischen Ökonomie. Statt sich damit zu beschäftigen, ob und wie sich eine Wirtschaftsform verändern ließe, überlegen effektive Altruisten, wie und wo sie am meisten Geld verdienen können, um dann umso mehr davon zu spenden, was nicht heißt, einen Feind, das Kapital, die Kapitalisten, den Profit, mit den eigenen Waffen schlagen zu wollen, weil es einen Feind nicht mehr gibt.
Auch der Philosoph Peter Singer, dem die Tiere einmal ein Denkmal errichten werden, bekennt sich zu dieser neuen, effizienten Form der Philanthropie. Kein Leid ist zu weit weg, um es nicht unter das Kalkül einer humanitären Kosten-Nutzen-Analyse zu bringen, die jeder, der Gutes tun möchte, anwenden sollte, damit Gutes nachweislich geschieht. Singer spendet regelmäßig einen Teil seines Gehalts für ausgewählte Zwecke in Ländern, von denen er so spricht, als seien sie in ihrer Entwicklung aus theoretisch unerfindlichen oder praktisch zu vernachlässigenden Gründen zurückgeblieben und müssten nun bei der Lösung ihrer Probleme, Hunger, Krankheit, Durst, Obdachlosigkeit, von jenen unterstützt werden, die in Nationen mit großem Wohlstand leben.
Wer sich jetzt als effektiver Altruist, von der Schweiz bis Australien, von Deutschland bis in die Vereinigten Staaten, aufmacht, sich im Verzicht zu üben und anderen mit Gaben zu helfen, der tut das nicht vor allem, weil er sein Gewissen beruhigen möchte, er sieht sich nicht unbedingt als Nutznießer einer Ordnung, die Armut und Reichtum produziert. So viel Theorie braucht heute keiner, der nicht nur reden, sondern handeln möchte.
Der effektive Altruist folgt der historisch und ideell etwas aseptischen, aber deshalb umso sachdienlicheren Einsicht, dass sich ein moralisch zu rechtfertigendes Leben in einem System von Überfluss und Mangel nur führen lässt, wenn er möglichst viel und sinnvoll Gutes tut, und zwar überall. Er muss nicht wissen, warum es in bestimmten Gegenden nicht regnet und nicht regnen wird, wenn er den Leuten helfen möchte, die dort verdursten, und er wird seine Zeit und seine Kräfte nicht damit vergeuden herauszufinden, was Geld ist, wenn er mit Geld verhindern kann, dass sich Krankheiten ausbreiten.
Das Motiv, warum einer sich dafür entscheidet, effektiver Altruist zu werden, liegt nicht notwendigerweise darin, dass er Mitleid mit den Armen hat. Auch effektive Egoisten lassen sich rühren. Peter Singer zieht Altruismus, etwas für andere tun, und Utilitarismus, dass das Wohlbefinden aller einen Maßstab für Handlungen hergeben soll, zusammen, damit die Empfindsamkeit für die Welt ein Ziel hat, das sich rational im Hinblick auf einen zu erreichenden Nutzen rechtfertigen lässt.
Ein individuelles Gefühl, Empörung, Traurigkeit, Liebe, wird zum Mittel und dient auf diese Weise einem allgemeinen guten Zweck. Wie der Christ muss auch der effektive Altruist zur Empathie mit anderen Lebewesen fähig sein, sonst würde er aus der Höhle des Ichs und des Vorteils nicht herausfinden. Es zahlt sich aus, zu geben: Das eigene moralische Glück lässt sich maximieren, indem das mangelhafte Glück der anderen gefördert wird. Der Egoismus der effektiven Altruisten findet seine Erfüllung im utilitaristisch klugen Verzichten.
Die Idee vom größtmöglichen Glück aller und von der größtmöglichen Leidensminderung für alle empfindsamen Lebewesen soll Altruisten dazu anhalten, effektiv zu sein, das heißt herauszufinden, zu analysieren, zu berechnen und zu kontrollieren, mit wie viel Geld sie wo und wie am besten helfen können. Wahllos hier und dort zu spenden beleidigt den Verstand, der dafür da zu sein scheint, dass er Zwecke und Gründe für Mittel und Entscheidungen sucht. Die alltäglich bewiesene Cleverness besteht beim Geben wie beim Nehmen darin, sich intellektuell erfolgreich zurechtzufinden, Einsatz und Ertrag in ein gewinnbringendes Verhältnis zu setzen.
Die Art des Wissens, das sich einer bei der Abwicklung von Geschäften in den Zentren des nationalen Wohlstands angeeignet hat und vorteilhaft einzusetzen versteht, kann ihm dabei helfen, einen Teil des erwirtschafteten Reichtums in die armen Regionen der Welt zu schaffen. Wie jede Bewegung des sozialen Wandels durch moralische Irritation und ethische Ideale setzt auch der effektive Altruismus seine Hoffnung darauf, dass immer mehr Menschen sich ihm anschließen werden, weil sie an ihre allgemeine Verantwortung für das Unheil auf der Welt glauben. Sie gehen nicht davon aus, dass sie einer bestimmten Tat für schuldig befunden worden sind.
Von seiner ideellen Architektur her gesehen gleicht diese junge Gruppenaktion einer Art Operationszentrum in wohlhabenden Nationen, ein moderner gläserner Bau, in dem die Verschickung von Gaben in die Dritte Welt geplant, organisiert und vorangetrieben wird, bis die ungerechte Verteilung des Glücks auf der ganzen Welt durch die Summe der Handlungen derjenigen, die glücklicher sind, so weit korrigiert worden ist, dass die Moral der einen und das Leben der anderen in einem stabilen Gleichgewicht sind. Der Einwand, dass es moralisch besser sein könnte, die Mitarbeit in Firmen aufzukündigen, die für die Armut anderswo unmittelbar verantwortlich sind, wird mit dem Hinweis erledigt, andere ständen bereit, die frei werdende Stelle zu übernehmen, hätten aber nicht die Absicht, das auf diese Weise verdiente Geld teilweise zu spenden.
Wer ein effektiver Altruist werden möchte, muss keine Angst davor haben, sich selbst verleugnen zu müssen. Keiner zwingt ihn, zum Wohl vieler etwas zu tun, das ihm zuwider wäre. Er soll aus Überzeugung handeln, und wenn er eingesehen hat, dass der Sinn seines Lebens auch und vor allem darin bestehen kann, Gutes zu tun, ohne selbst darunter leiden zu müssen, dann wird er die Gelegenheit zur moralischen Selbstvervollkommnung und Verbesserung der Welt ergreifen. Wichtig ist dabei nur, dass er sich seiner Sache sicher ist. Hier soll ihm die Kosten-Nutzen-Analyse des Utilitarismus hilfreich zur Seite stehen, eine Art unternehmerische Rationalität der Moral, die dazu dient, herauszufinden, wo sich was mit den größten Gewinnerwartungen investieren lässt. Er kann jetzt mit sich zufrieden sein, er hat sich nach besten Kräften kundig gemacht und aus den Informationen nach besten Kräften einen rationalen Schluss gezogen.
Ein beliebtes Reflexionsmodell des moralisch kalkulierenden Verstandes sind das Fallbeispiel und das Gedankenexperiment, die Hochrechnung der Folgen von Absichten und Handlungen, die vergleichende Engführung von Werten und Optionen. Ist es im Hinblick auf die Förderung des allgemeinen Wohlbefindens besser, fragt Singer, Geld für den Anbau eines Kunstmuseums auszugeben oder damit ein zur Blindheit führendes Augenleiden von tausend Menschen in den Entwicklungsländern zu heilen? Jedem, dem es wichtig ist, ökologisch gut und gerecht zu handeln, sind solche Einzelfallberechnungen und Schadenbegrenzungen beim Kauf von Bananen, Smartphones, Kleidung und bei Fahrten mit Auto, Bahn, Flugzeug bekannt. Das global bewusst geführte westliche Leben zerfällt in Handlungen, die vorab daraufhin untersucht werden, inwiefern sie gegenwärtiges oder zukünftiges nahes oder fernes Glück im errechneten oder prognostizierten Durchschnitt minimieren, erhalten oder fördern.
Das überlegte Verzichten liegt nahe beim bewussten Genießen. Die Klammer, die beide Tugenden eines um kritische Warenanalyse und den moralischen Mehrwert des eigenen Glücksstrebens bemühten Marktteilnehmers zusammenhält, ist die Kontrolle über sich selbst, größte hedonistische Dehnung des urbanen Ichs auf moralisch engstem Raum, eine im Hinblick auf Glück und Gerechtigkeit jeweils erstellte Bilanz von Geben und Nehmen. Effektive Altruisten sind keine Heiligen, Märtyrer oder Asketen, sie müssen auch keine radikalen Aussteiger, Verweigerer oder Nonkonformisten sein, die der Gesellschaft, in der sie leben, den Rücken kehren, sie bekämpfen oder sich zu alternativen Lebensformen im sozialen Abseits zusammenfinden.
Die Biographien, die Singer erzählt, lassen vermuten, dass es sich um Menschen handelt, die wissen wollen, was sie hier und jetzt tun und tun sollen, die sich Gedanken darüber machen, wie sich ein vernünftig zu rechtfertigendes Leben auf der Grundlage all der erreichbaren Informationen über den Zustand der Welt und das Leid von Menschen führen lässt, und die sich dabei vielleicht manchmal doch zu überfordern scheinen, so wie einer, der nicht körperlich arbeiten muss, in seinem Drang, sich fit und gesund zu halten, vielleicht zu viel trainiert, zu eifrig und verbissen an seinem Programm zur Ertüchtigung festhält. Singer sagt, dass es für effektive Altruisten kein Ideal gebe, das sie erreichen müssten, sondern nur Schritte auf einem Weg, der zum Guten führt, so dass jeder das tun sollte, was er zu tun vermag, was ein wenig so aussieht wie: junge Leute, auf Laufbändern, konzentriert, lächelnd, hinter Glas, den Blick auf den Bildschirm vor ihnen, das Beste wollend.
EBERHARD RATHGEB
Peter Singer: "Effektiver Altruismus. Eine Anleitung zum ethischen Leben". Aus dem Englischen von Jan-Erik Strasser. Suhrkamp, 240 Seiten, 24,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
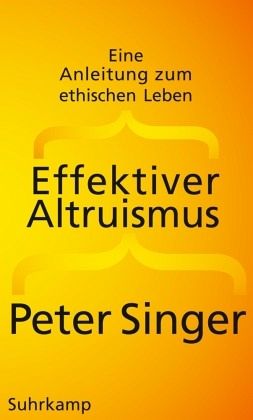





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.05.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.05.2016