gleichgeblieben. Immer wieder kehrt ein Held heim, immer wieder muß er die Stadt - und mit ihr das Vaterland - für sich selbst erobern, und immer wieder geht es um das Dableiben, das Fortgehen und das Fortgehen im Dableiben. Aber Berlin ist jetzt vereint, und Deutschland ist es auch. Mit "Eduards Heimkehr", Peter Schneiders jüngstem Roman, wird eine Trilogie des Wiedersehens abgeschlossen.
Dem Protagonisten ist der Leser also schon mehrfach begegnet. Er trägt nicht nur denselben Namen wie jener bekannte Baron im besten Mannesalter, sondern heißt auch wie der Held in den "Paarungen", Peter Schneiders vorangegangenem Roman. Mit diesem teilt er ebenfalls den Beruf des Molekularbiologen, und beide Eduards - und natürlich der Autor - haben darüber hinaus die wichtigsten biographischen Daten mit den Hauptfiguren von "Lenz" und "Mauerspringer" gemein. Sie haben ihre späte Jugend in der Studentenrevolte verbracht, sie haben akademische Lebensläufe, sie gehen zu Vorträgen über die Intellektuellen und die Moral, sie sind Schwerenöter in Fragen der Liebe, und sie sind emphatische Zeitgenossen - kurz: Sie sind genauso exemplarische Gestalten wie ihr Dichter.
Eine literarische Figur, die so erkennbar als halboffizielle Gestalt angelegt ist, hat es mindestens so schwer wie eine halbamtliche Nachrichtenagentur. Denn da ist auf der einen Seite die Forderung der Literatur, ein Held möge mehr sein als ein Strichmännchen, das auf dem weißen Papier herumzappelt, ohne zu wissen, was es da verloren hat. Da ist aber auf der anderen Seite eine Zeitgeschichte, die mit Macht in diese Figur drängt. Um ihretwillen verwandelt sich der Held in eine ratternde und schnaufende Wahrnehmungsmaschine. "Es war ihm", und "er glaubte", "er spürte", und es "fiel ihm ein", "er las", und "er fand", er "hatte das Gefühl", "er spürte", und er hatte "irgendwo gelesen" - ohne jemals auszuruhen, futtert sich dieser Eduard durch die Berliner Gegenwart, vorangetrieben von einem offenbar unstillbaren Hunger nach der prägnanten Bemerkung, nach dem sprechenden Bild, nach dem Stück Gegenwart, das am besten schon morgen als beispielhafte Beobachtung aus der jüngsten deutschen Geschichte durch die ganze Welt kolportiert werden kann.
Die Geschichte ist schlicht: Eduard, der alte Westberliner, wird aus Kalifornien an ein Forschungsinstitut im Osten Berlins berufen und kehrt in eine von Grund auf veränderte Stadt zurück - nichts ist mehr, wie es einmal war, nicht die Freunde, nicht die Kneipen, nicht die Weltanschauungen. Außerdem hat er in der "historischen Lotterie" der Restitution ein Haus in Friedrichshain geerbt, in dem sich - wie sollte es anders sein - ein paar Besetzer niedergelassen haben. Die weitgehend amerikanisierte Familie bleibt fürs erste in den Vereinigten Staaten wohnen, und es kostet ihn einige Mühe, sie von einem Umzug zu überzeugen. Und weil selbst diese drei aufeinandergestapelten Motive nicht ausreichen, um aus einem Strichmännchen einen Romanhelden zu machen, hat der Dichter seinen Eduard auch noch mit einem höchst privaten Problem ausgestattet: Er fühlt sich als erotischer Versager, weil er seine Frau nicht zum Höhepunkt bringen kann. Und so stolpert der Roman langsam der Erlösung entgegen.
In den achtziger Jahren gab es eine Schreckgestalt, die in Berlin besonders verbreitet war: den Metropolenkundler, den intellektuellen Heimatforscher. In diesen Berlinologen ging das kritische Bewußtsein, auf das man sich in dieser Stadt besonders viel eingebildet hatte, binnen kurzer Zeit bankrott: Jedes Haus, jede Wasserleitung und jedes Marzipanhörnchen aus dem Café Kranzler wurde plötzlich mit dem Willen betrachtet, aus dem unscheinbaren Detail eine höhere Bedeutung zu destillieren. Der Berlinologe, ein Franz von Assisi des urbanen Hausrats, überzog die Stadt mit dem dunkel schillernden Glanz der historischen Anekdote, und staunend blieb man vor diesem Wunder stehen. Alle politischen Gegensätze, alle substantiellen Konflikte verloren ihre Härte, ihre Konturen lösten sich auf.
In Peter Schneiders Roman hat der Berlinologe überlebt, und zwar als Historiker der stadtläufigen Meinungen: "Du lieber Himmel", läßt der Dichter ausrufen, "Berlin ist wirklich ein Gewächshaus mit einem eigenartigen Klima." Es gibt keine auch nur halbwegs große Nachricht aus dem Berlin der vergangenen zehn Jahre, die in diesem Buch nicht wenigstens wie eine Quartettkarte erhoben und gezeigt worden wäre: die Debatte um die Akten des Staatssicherheitsdienstes, der Streit um das Mahnmal, die Auseinandersetzung um das Stadtschloß, die Turnschuhe der Ostberliner, die Zeitungsprojekte der werdenden Hauptstadt, die Lage der Professoren, die Gerüste am Potsdamer Platz, die Kneipen am Prenzlauer Berg. Für alles findet sich ein Platz.
Die vielen Nachrichten werden in einem immer gleichen Duktus vorgetragen. "Die Stadt war offenbar verrückt geworden", heißt es zum Beispiel, "die Zeitungen brachten fast täglich Berichte über Gewalttaten aus nichtigem Anlaß." Oder: "Es war, als sei die halbe Stadt verpackt worden und warte auf die Verschickung." Oder: "Man hatte Plurale gebildet, man scheute den Singular, man reimte Väter auf Täter, sprach . . . aber selten vom eigenen Vater oder Großvater." Nichts von alledem wird konkret, das meiste bleibt Gemeinplatz, und alles, was vorgibt, die spontane Äußerung eines lebendigen Wesens zu sein, wirkt wie eine Verlautbarung aus dem hohlen, runden Kopf jenes Strichmännchens. Peter Schneider läßt nicht Menschen, sondern Meinungsträger auftreten, über die er sich mit überlegener Miene beugt. Was dabei entsteht, ist eine sonderbare Talkshow, in der die Literatur als Moderatorin auftritt. Sie ist die Pontifikalform von Landeskunde.
Vor hundert Jahren lebte ein Dichter, den man mit Fug und Recht den letzten deutschen Nationalschriftsteller nennen könnte: Ernst von Wildenbruch. Von ihm stammt der auf Bismarck gemünzte Satz, für die Deutschen sei "politisches Denken immer zu drei Vierteln Gefühlspolitik". Beschrieben ist damit weniger der gewesene Kanzler des Deutschen Reiches als ebendieser Dichter. Peter Schneider verfaßt zwar keine patriotischen Dramen, und man erwartet von ihm auch kein Heldengedicht auf Gerhard Schröder. Doch gibt es eine tiefe Verwandtschaft zwischen den beiden. "Der Historiker liest im Buch der Geschichte die Zeilen, / Zwischen den Zeilen den Sinn liest und erklärt der Poet", hatte Wildenbruch verkündet, und Schneider gehorcht diesem Prinzip. Wenn er eine Vielzahl von Meinungen aus und über Berlin spazierenführt, Meinungen, die sich am Ende dann doch nur zu einem einzigen großen Bekenntnis zu dieser Stadt und zu diesem Land verdichten, dann verbirgt sich hinter dem gewaltigen Räsonnement eine Gefühligkeit, die Vernunft nur simuliert. Peter Schneider besingt das Ideal einer nationalen Gemeinschaft.
So kommt am Ende alles zusammen. Das geerbte Haus wird mit Abschlag an einen Besetzer verkauft, der Held richtet sich mit seiner ganzen Familie in einer Dachwohnung in Charlottenburg ein, und wo der Stadtkörper so zu seinem Recht kommt, da darf der Körper der Frau nicht zurückbleiben. Irgendwann "hörte er etwas wie einen sirrenden Pfeil, der sich von einer zurückschnellenden Sehne löst, sah Jenny sich im Schmerz zurückbiegen, hörte einen himmlisch schönen Seufzer, etwas wie ein lebenslang aufgeschobenes Ausatmen". Der Berliner ist endlich beseelt, der unverkrampfte Deutsche hat das Ziel erreicht, Hauptstadt und Dichterheld sind eins geworden. "Nur ein ganzer Mensch, bei dem Kopf und Herz, Licht und Wärme, Verstand, Gefühl und Wille in voller Harmonie stehen, nur ein solcher vermag zu heilen, zu retten und zu erlösen." So denkt Peter Schneider. Der Satz stammt von Ernst von Wildenbruch.
THOMAS STEINFELD
Peter Schneider: "Eduards Heimkehr". Roman. Rowohlt Berlin, Berlin 1999. 432 S., geb. 45,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
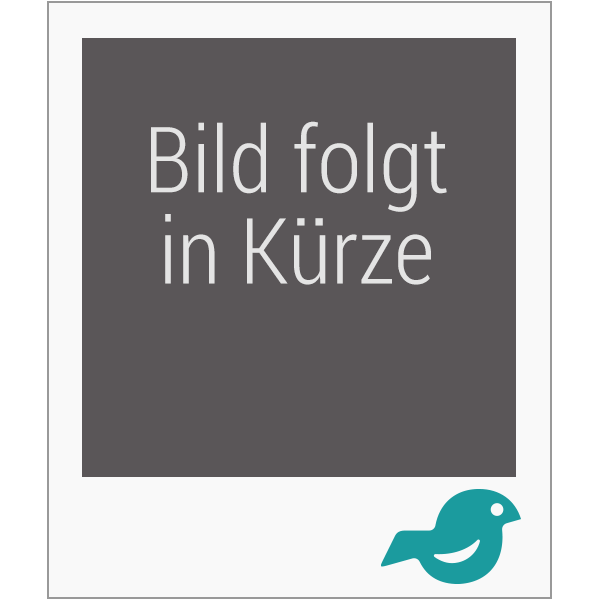



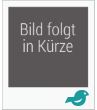

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.07.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.07.1999