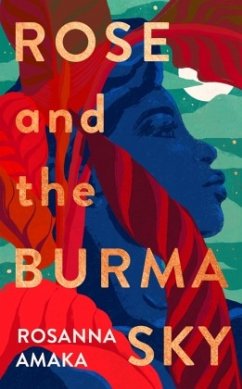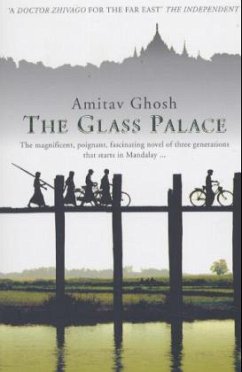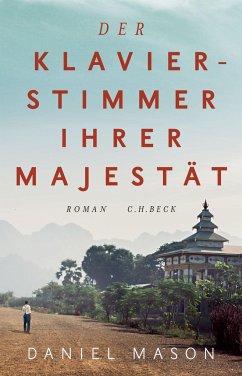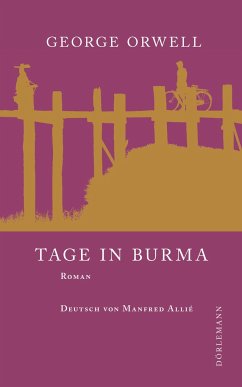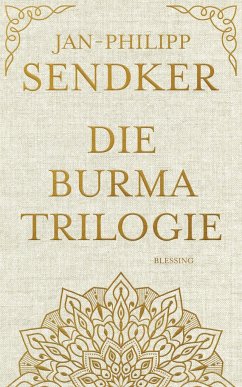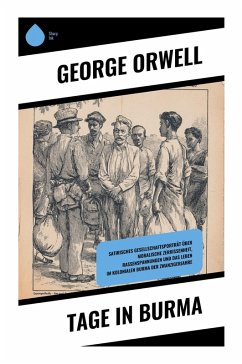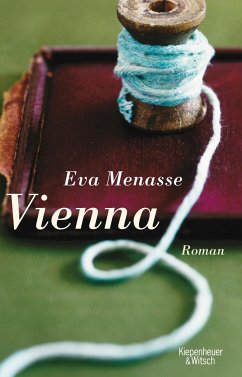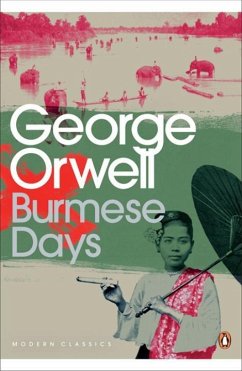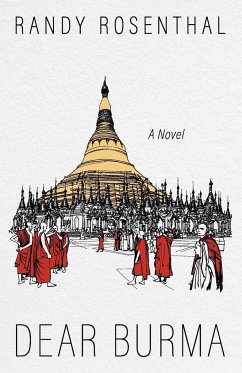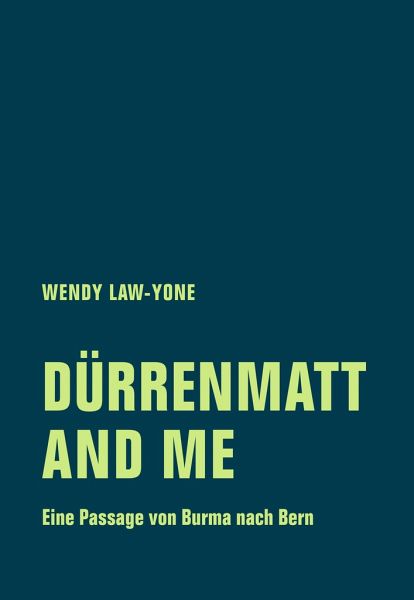
Dürrenmantt and me
Die Passage einer Schriftstellerin von Burma nach Bern
Herausgegeben: Lubrich, Oliver;Mitarbeit: Denger, Marijke

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die burmesisch-britische Autorin Wendy Law-Yone beschreibt in diesem Buch, wie wichtig für sie und ihr Schaffen die Begegnung mit der deutschen Sprache und dem Werk Friedrich Dürrenmatts gewesen ist. Über die deutsche Sprache kam sie zum Schreiben. Beindruckt von Dürrenmatts Tragikomödie »Der Besuch der alten Dame« beschäftigte sie, die von der Militärdiktatur aus ihrem Land vertrieben wurde, sich insbesondere mit dem Thema der Rache. Ihr Bericht ist sehr persönlich, offen und heiter.Dieser Band präsentiert einem deutschsprachigen Publikum erstmals das Werk einer postkolonialen Auto...
Die burmesisch-britische Autorin Wendy Law-Yone beschreibt in diesem Buch, wie wichtig für sie und ihr Schaffen die Begegnung mit der deutschen Sprache und dem Werk Friedrich Dürrenmatts gewesen ist. Über die deutsche Sprache kam sie zum Schreiben. Beindruckt von Dürrenmatts Tragikomödie »Der Besuch der alten Dame« beschäftigte sie, die von der Militärdiktatur aus ihrem Land vertrieben wurde, sich insbesondere mit dem Thema der Rache. Ihr Bericht ist sehr persönlich, offen und heiter.Dieser Band präsentiert einem deutschsprachigen Publikum erstmals das Werk einer postkolonialen Autorin, die im englischsprachigen Raum bereits eine anerkannte Größe ist.