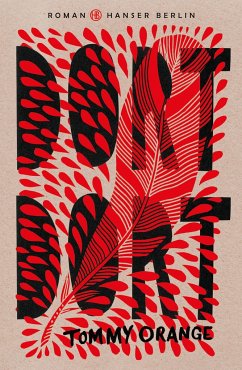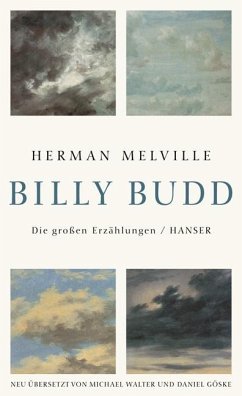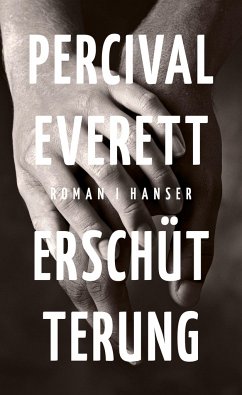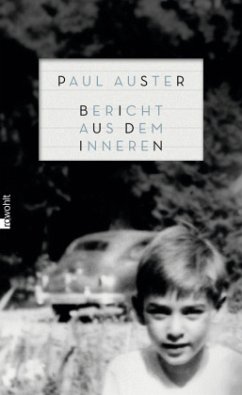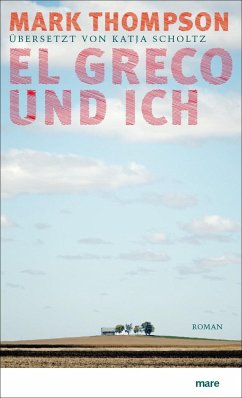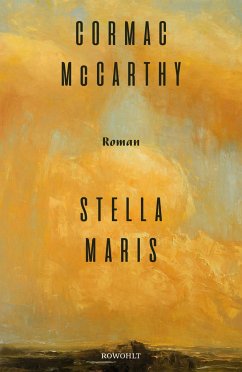vorher?
Die ersten 150 Seiten von David Vanns "Dreck" sind die Hinführung zum Horror, und sie sind gleichermaßen fürchterlich: fürchterlich banal. Wir befinden uns im Kopf von Galen Schumacher, einem zweiundzwanzigjährigen Mann, der noch bei seiner Mutter Suzie-Q lebt. Diese wiederum betreibt die Walnussplantage, die ihr aus Deutschland eingewanderter Vater angelegt hat. Verheiratet war der mit einer Isländerin, und für Galen steht schon deshalb fest, dass im Leben seiner Familie niemals etwas zusammenpassen wird. Nun ist der Großvater tot, die Großmutter musste wegen beginnender Demenz ins Altersheim umziehen, und von seinem eigenen Vater kennt er nicht einmal den Namen. Mutter und Sohn sind allein zu Haus.
Die Plantage ist das letzte unbebaute Areal in diesem Vorstadtgebiet, doch Suzie-Q denkt gar nicht daran, das wertvolle Grundstück zu Geld zu machen. An ihm hängen all ihre glücklichen Kindheitserinnerungen, an dem Dreck, aus dem die Bäume wachsen und dem der Roman seinen Titel verdankt (im Original "Dirt", also etwas weniger pejorativ). Es gibt aber noch viel mehr Schmutz, der im Laufe des Geschehens unter dem Teppich hervorgekehrt und reichlich über die Beteiligten verteilt wird.
So hat der Großvater von Galen seine Frau und ältere Tochter Helen geprügelt, aber niemals das Nesthäkchen, und ans Leid von Mutter und großer Schwester will Suzie-Q sich nicht erinnern. Um ihr eigenes Kinderglück zu verlängern, hat sie erst ihren Sohn in die Welt gesetzt und ihn dann nicht mehr losgelassen. Auf der Bank liegt ein Familienvermögen in unbekannter Höhe, über das nur sie unbeschränkt verfügen kann, doch ihrem Sohn sagt sie, dass nicht genügend Mittel vorhanden seien, um ihn studieren zu lassen. So ist Galen ein Gefangener in der Welt seiner Mutter und rettet sich in Vorstellungen von Reinkarnation. Wie sollte er sein Leben sonst ertragen?
Das Ganze spielt in den achtziger Jahren (die amerikanische Originalausgabe legt sich im Klappentext auf 1985 fest), aber der einzige Grund, warum Vann seinen Roman in jener Zeit angesiedelt hat, dürfte darin liegen, dass es damals noch keine Mobiltelefone gab; die hätten einige Wendungen des Geschehens empfindlich gestört. Unter den Twens dieser Zeit dürfte Galen kaum als solch ein Sonderling erschienen sein, wie Vann ihn beschrieben sehen will: Castaneda- und Hesse-Lektüre waren immer noch verbreitet, und Kitaros weichgespülte Musik fand durchaus auch junge Liebhaber.
Aber dieser träumende Softie ist hochgefährdet und -gefährlich, und so wird er zum jüngeren Bruder im Geiste von Gary, dem Protagonisten von "Die Unermesslichkeit", dem Romanvorgänger von "Dreck", in dem Vann eine Ehe zum Schlachtfeld machte. Und noch mehr erzählerische Verwandtschaft besteht zu Roy, dem Halbwüchsigen aus "Im Schatten des Vaters", dem Buch, mit dem der 1966 geborene Amerikaner bei uns bekannt wurde und in dem er nur notdürftig fiktionalisiert die tragische Geschichte seiner eigenen Familie erzählt. Die Verletzungen, die dieser Autor erlitten hat, sind tief, und die literarischen Heilmittel, die er wählt, sind nichts für schwache Nerven.
Galen ist nach dem berühmten Arzt der Antike benannt; er sollte ja Suzie-Qs Wohlbefinden garantieren. Doch von Beginn des Geschehens an stehen die Störungen des jungen Mannes selbst im Zentrum: Sexuell läuft es nur mit sich selbst, und die Nahrungsaufnahme wird zum Ausgangspunkt aller familiären Konflikte. Erst als Galen selbst die Initiative ergreift, sich ernährt wie ein schiffbrüchiger Leichtmatrose, kann er die Nahrung bei sich halten, weil er ein Äquivalent zu seiner Stimmung im Essen gefunden hat: "Er setzte sich und gabelte die grünen Bohnen aus der Dose, kalt und salzig und ohne anderen Geschmack. Er kaute und schluckte, und es fühlte sich an, als wäre sein Magen eingefallen, als müsste das Essen die Falten von innen wieder ausbeulen. Er gabelte Sauerkraut und genoss den Essig. Essig war das Richtige." Aber mit diesem Zitat sind wir schon im zweiten Teil.
Der bietet das, was Vanns besondere Fähigkeit ausmacht: den tetanisierenden Blick auf Zweierbeziehungen, Vater-Sohn, Mann-Frau oder jetzt Mutter-Sohn. Man steht starr vor den Konsequenzen dieses Schreibens, an vergleichbarer Intensität gibt es nichts. Genau deshalb aber ist die Lektüre der ersten Hälfte von "Dreck" so desillusionierend. Das Schreckenspanoptikum des Daniel Vann umfasst hier noch fünf Personen: Mutter-Sohn-Großmutter-Tante-Cousine. Oder anders gesagt: Galen allein unter Frauen.
Leider ist das des Schlimmen vierfach zu viel. Wie Galen in den erotischen Bann seiner Cousine Jennifer gerät, ist nicht psychologisch ausgefeilt, sondern pornographisch aufgegeilt. Und die Hennenkämpfe zwischen Suzie-Q und Helen unter den umnebelten Blicken ihrer verwirrten Mutter laufen nach den Dialogschemata von Fernsehserien ab. Da hilft es nicht, dass Vann einen eigenen Stil zu etablieren sucht, der gern in einzelnen Sätzen auf Verben verzichtet, um Gefühlsintensität zu simulieren. Das klingt in der vorlagengetreuen Übersetzung von Miriam Mandelkow dann so: "Also machte er die Augen zu, sah Grellpink mit weißen Glimmerspuren und Sonneneruptionen, eine endlos variable, explosive Welt. Sein Körper kreiselnd im Licht. Gesicht und Schenkel glühend heiß, Stecknadeln. Aber er würde hier bleiben, bis zum Ende."
Doch in Wirklichkeit will Galen nur weg. Als Suzie-Q ihm diese Illusion endgültig nimmt, ist die zweite Hälfte des Romans erreicht, und damit beginnt sein meisterhafter Teil. Alle außer Mutter und Sohn haben die Handlung verlassen, wir sind wieder im Vannschen Naturzustand der vergifteten Zweisamkeit. Von Poes "Tell-Tale Heart" hat das Finale einiges gelernt. Doch was abschließend passiert, macht diesem Autor so schnell keiner nach. (Man möchte auch keinem Schriftsteller wünschen, dass er es so überzeugend könnte.)
ANDREAS PLATTHAUS.
David Vann: "Dreck". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Miriam Mandelkow. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013. 298 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
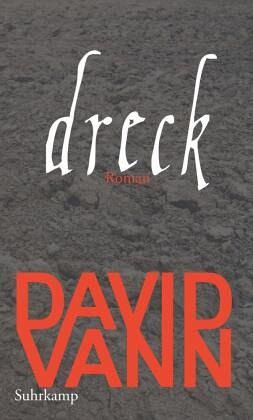





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.03.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.03.2013