reizenden Vornamen längere Zeit in Syrien verbracht und betreibt in der dänischen Hauptstadt ein Geschäft für orientalische Waren. Eine Fachfrau also für Aladin, Sindbad & Compagnon?
Kein Zweifel, daß sie sich auskennt im syrischen Gastland. Außerdem war sie vorsichtig genug, keine arabische Figur in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eine junge Frau aus dem Okzident, nämlich eine amerikanische Journalistin namens Samia Rose Robinson. Das Problem war, diese Heldin mit der gleichen Orientsucht auszustatten, die offensichtlich in der Seele der Autorin waltet. Iselin C. Hermann fand folgende Lösung: Samia, Tochter eines amerikanischen Diplomatenpaares, wurde in Damaskus gezeugt und in Amman geboren. Zwar verließ sie jene Weltecke schon im Alter von sechs Monaten, aber in all ihren amerikanischen Werdejahren verlor sie nie die Sehnsucht nach dem Ursprung ihres Ichs. Der Wunsch, ihn aufzuspüren, ist der Antrieb für ihre Reise nach Syrien.
Staunend nimmt man zur Kenntnis, daß Erlebnisse als Säugling so nachhaltig wirken können. Immerhin ließ Samia ihren jüdischen Geliebten Isak in New York zurück, wohlwissend, daß dem ihr Geburtsland verschlossen ist. Sie kann ihn kaum übermäßig geliebt haben, auch wenn in mannigfachen Telefonaten zwischen den Kontinenten die Bindung zwischen beiden noch zu atmen scheint. Vermag Samia überhaupt zu lieben? Das hängt davon ab, welchen Sinn wir diesem Begriff zuordnen. Samia, obwohl orientbesessen, ist von eher laxer Moral geprägt. Sie weiß sehr wohl, was die syrische Umgebung von der Frau erwartet, doch in diesem Punkte stellt sie das eigene Ego höher als alle Tradition.
Sie knüpft zwei neue Beziehungen, eine zu Jameel, dem Sänger, die andere zum Geschäftsmann Nadir. Im Falle Jameel ist es Liebe, im Falle Nadir reiner Sex, und die Autorin Hermann wird nicht müde, uns in beiden Fällen überreichlich mit den Gedanken und Gefühlen der drei Beteiligten zu versorgen. Dieses Übermaß allerdings fällt nicht weiter auf, denn eigentlich besteht der gesamte Roman nur daraus, Gedanken und Gefühle der jeweils vorgeführten Personen zu zitieren: Samias, ihrer Anbeter, ihrer Eltern, aller wie immer gearteten Figuren aus Vergangenheit und Gegenwart. Der ständig wechselnde Blick in diverse Hirne ist der Trick, mit dem der Roman uns jeweils denken macht, was wir denken sollen, über das, was war, über das, was ist.
Mit dem er dies jedenfalls versucht. Er scheitert dabei immer wieder. Schon die Orientmanie der Heldin leuchtet nicht zwingend ein, zum einen in Anbetracht der Herkunft, zum anderen, weil Samias angebetete Araberwelt jenseits aller Traumdüfte und Zaubertöne sich als abstoßender Überwachungsstaat entpuppt, in dem jeder jeden belauert und gegen eigenen Vorteil preisgibt. Wie kann man sich dafür begeistern? Man wüßte auch gern, was die Journalistin Samia ihren amerikanischen Auftraggebern eigentlich liefert. Ihr Job wird uns zwar dauernd ins Gedächtnis gerufen, aber es bleibt dunkel, wofür die Honorare gezahlt werden, mit denen sie ihr damaszenisches Lotterdasein finanziert.
Dunkel bleibt auch für lange Zeit, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Ein Roman als orientalisch-okzidentaler Seelenzustandsbericht, sonst nichts? Weit gefehlt, denn wir müssen uns auf einen finalen Schock gefaßt machen. E-Mails der Heldin an ihren Vater verraten uns, allerdings erst kurz vor Schluß, daß Jameel denselben Erzeuger hat wie seine Anbeterin, der geliebte Sänger ist das Produkt des Seitensprungs, an dem die Ehe von Samias Eltern zerbrach. Der Betthengst Nadir hat Samia mit diesem Geheimnis erschlagen, denn als hoher Funktionär der gegenseitigen Überwachung weiß er so gut wie alles, und er ist sehr eifersüchtig. Eine schöne Bescherung, fürwahr, und zugleich das Ende der Geschichte. Wohin Samia sich nun verziehen wird, müssen wir uns selber ausdenken.
Soweit der Inhalt. Und die Form? Die Autorin müht sich nicht ohne Geschick um einen poetischen Touch, macht auch gern von der liedhaften Sprache des Korans Gebrauch, dessen Suren sie reichlich zitiert. So ist man geneigt, den Unsinn, der manche Zeilen verdirbt, der Übersetzerin anzurechnen. Freilich können wir, des Dänischen nicht mächtig, das nicht zuverlässig beurteilen. Doch wie auch immer, manche Wendungen lassen sich nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen. Zum Beispiel: "... kaum habe ich meine Slips zum Trocknen aufgehängt, sind sie es schon. Zu Hause stehen sie mit Schlittschuhen vor dem Rockefeller Center." Oder: "Ich muß mich auch heute noch zwingen, ein Glas Wasser mit der linken Hand zu trinken." Was immer gegen Samia und ihre Besessenheiten einzuwenden wäre - so etwas hat sie nicht verdient.
SABINE BRANDT
Iselin C. Hermann: "Dort, wo der Mond liegt". Roman. Aus dem Dänischen von Regine Elsässer. Deutsche Verlagsanstalt, München 2003. 185 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
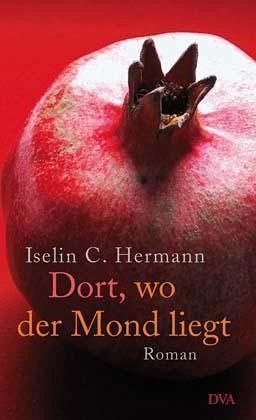



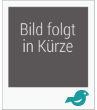

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2003