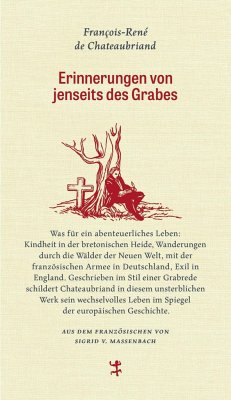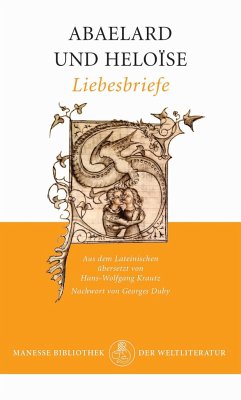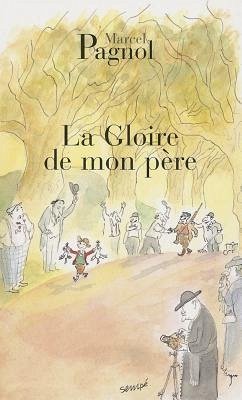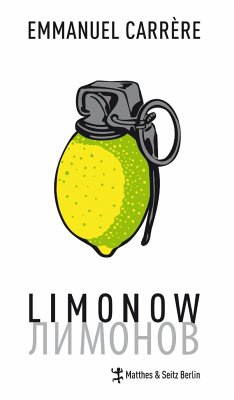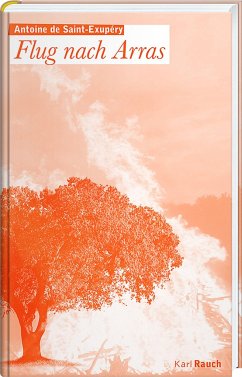Nicht lieferbar

Doppelmemoiren
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Am Ende seines Lebens schrieb einer der großen, in Vergessenheit geratenen Theaterklassiker ein einzigartiges Stück Literatur. Auf wenigen Seiten hat Jean Giraudoux seine Kindheit und die Zeit seines Erwachsenenlebens bis kurz vor seinem Tod 1944 wie in einem Spiegel parallel nebeneinander herlaufen lassen. Die große Geschichte, die er als Diplomat beobachten konnte, taucht auf wie ein Privatissimum, die Kindheit in der südfranzösischen Provinz als poetische Erklärung der Welt aus der Froschperspektive. In seiner Poesie, seiner boshaften Klarheit, der lakonischen Art der Beobachtung konn...
Am Ende seines Lebens schrieb einer der großen, in Vergessenheit geratenen Theaterklassiker ein einzigartiges Stück Literatur. Auf wenigen Seiten hat Jean Giraudoux seine Kindheit und die Zeit seines Erwachsenenlebens bis kurz vor seinem Tod 1944 wie in einem Spiegel parallel nebeneinander herlaufen lassen. Die große Geschichte, die er als Diplomat beobachten konnte, taucht auf wie ein Privatissimum, die Kindheit in der südfranzösischen Provinz als poetische Erklärung der Welt aus der Froschperspektive. In seiner Poesie, seiner boshaften Klarheit, der lakonischen Art der Beobachtung konnte ein solch intimes, distanziertes Werk nur in Frankreich entstehen. In der europäischen Literatur hat der Text nicht seinesgleichen: Giraudoux' Memoiren lohnen die späte Entdeckung.