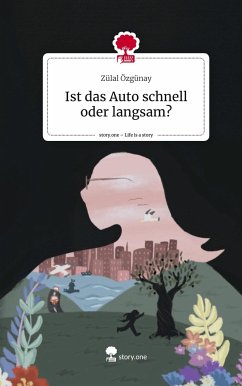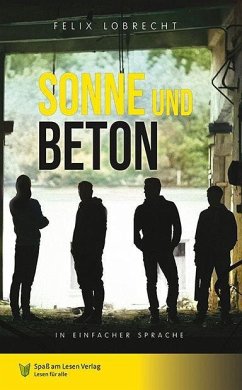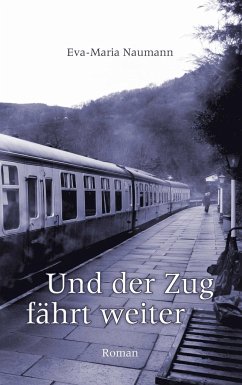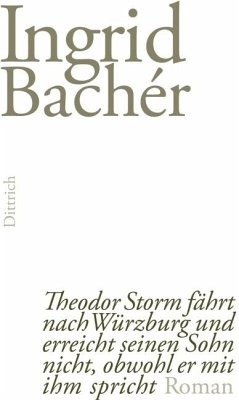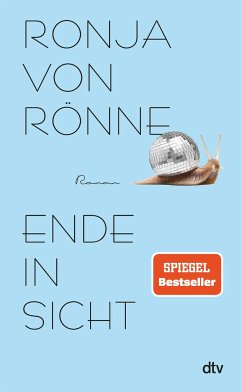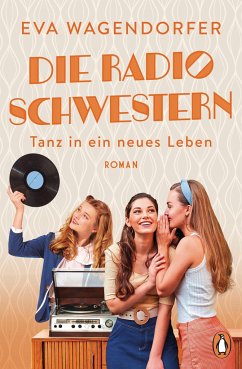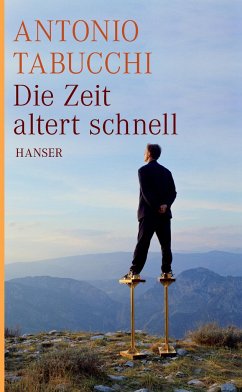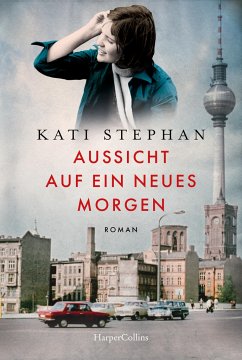nämlich auch Menschen. Der Labrador, erzählt ein neurotischer Hundehasser seinem Psychologen, "ist verwöhnt, der Labrador hat das, was ich nie gehabt habe. Er wohnt direkt am Fluß, in erster Reihe sozusagen, nicht in der dritten so wie ich". Aber als der Therapeut eines Nachts seinen toten Labrador als Haßobjekt anbietet, schlägt sein Patient lieber gleich den Doktor.
Arne Nielsen erzählt kaltblütig und ungerührt von ganz normalen Menschen, die fast grundlos und ohne Reue Hühner, Hunde, Mütter und Kinder totschlagen. In "Bursche ist da" überfällt eine Hebamme plötzlich die Lust, das neugeborene Kind an die Wand zu klatschen, während der Onkel nebenan still nach Hause strebt, um seinem Hobby zu frönen: in Apfelsinen onanieren. In einer anderen Geschichte klingelt ein vielgeprüfter Hiob mitten in der Nacht, um sich von seinem Nachbarn - ohne sexuelle Absichten - auf Hodenkrebs untersuchen zu lassen. Einsame Menschen tun manchmal ziemlich verrückte Dinge, um Trost und Gesellschaft zu finden, und Arne Nielsens Helden sind alle einsam und krank, häßlich, böse und vor allem unberechenbar: Neurotiker, empfindsame Metzger, apathische Choleriker, gutmütige Sodomiten, kurz: Biedermänner in der Maske des Triebtäters. Selbst Arnold, der einsame Hollywood-Star, will sein Auto unbedingt inkognito, in den Shorts seines Sohnes, in einer fremden Garageneinfahrt waschen.
Der Lebenslauf in absteigender Linie weist den zweiunddreißigjährigen Dänen als literarischen Seiteneinsteiger aus: Studium der Wirtschaftswissenschaften, Lehre als Herrenschneider, Jobs als Konsularbeamter, Tankwart und Friedhofswächter. Auf dem Friedhof könnten Nielsen auch die vierzehn Erzählungen seines Prosadebüts zugeflogen sein. Seine Geschichten sind makaber, bizarr, oft auch unappetitlich, in surrealen Traum- und Parallelwelten angesiedelt, aber durchaus innerhalb des Kontinuums menschlicher Verirrungen und alltäglicher Perversionen. Nielsens Figuren sind Außenseiter und exzentrische Sonderlinge, die gemütlich ins Zentrum der Normalität spazieren wollen und sich unversehens, verwundert und verwundet, im Abseits wiederfinden. Es sind Ungeheuer mit guten Vorsätzen, Monster aus Sanftmut, Ekelpakete mit rosa Schleifchen.
Und Naschkatzen. Ständig stopfen sie Pralinen, Chips, Lakritze, Kuchen und Unmengen von Limonade in sich hinein. Es braucht nur eine kleine Demütigung, eine leise Enttäuschung, ein falsches Wort als Hefe, und schon beginnt der Zucker des Bösen zu gären, Faulgase und ätzende Laugen freizusetzen. Nielsen macht nicht viel Aufhebens von diesen seltsamen Zersetzungsprozessen. Er verweigert Erklärungen und gibt keine Auflösung. Nur so viel ist sicher: Man kann Tür an Tür leben und doch unentdeckte Leichen im Keller haben, wie familiäre Succubi aufeinander hocken und einander doch unendlich fremd und fern bleiben. Zwischen den Zeilen, im Innern einer schmucklosen Sprache, ist Platz genug für namenlose Geheimnisse, verdrängte Lüste, verschwiegene Laster.
Das Gesellenstück des Herrenschneiders Nielsen ist kein Meisterwerk; es gibt etliche lose Fäden und Flickwerk, hin und wieder auch modische Raymond-Carver-Applikationen. Aber Nielsen hat seinen Stoff lakonisch knapp und kühl auf Kante genäht, und deshalb paßt sein erster Anzug gar nicht so übel.
MARTIN HALTER
Arne Nielsen: "Donny hat ein neues Auto und fährt etwas zu schnell". Erzählungen. Liebeskind Verlag, München 2003. 128 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
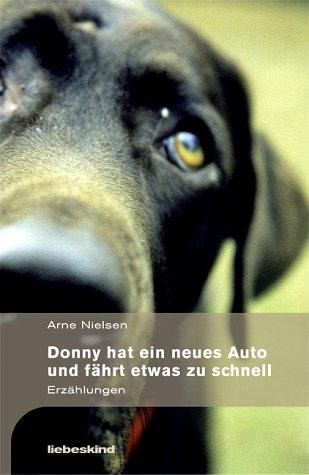




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.12.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.12.2003