London School of Economics, hat die Neuauflage des Begriffs vom Dritten Weg geprägt, der zur Mitte des vergangenen Jahrzehnts den Programmen Tony Blairs und Gerhard Schröders geistig Pate stand. Der englische Buchtitel suggeriert die Tendenz der Aufsätze, denn wohin richtet sich der Blick, wenn man am Rande steht, wenn nicht in einen Abgrund?
Die Globalisierung, wie sie die dreizehn Autoren dieses Bandes wahrnehmen, breitet sich über Ländergrenzen, Rechtssysteme und Kulturkreise aus, vorangetrieben durch multinationale Konzerne, die überall dort Arbeitskräfte einsetzen und Kunden suchen, wo sie sich die größten Gewinnspannen versprechen. Die Triebfeder multinationaler Konzerne ist die Gewinnmaximierung, und diese Flutwelle überspült, was nicht ihren Zwecken dient. Der Reichweite traditioneller sozialer Rahmen wie Staat, Gesellschaft und Familie sind geographische Grenzen gesetzt, und sie werden von der Globalisierung überflutet wie Sandburgen vom Meer. So produziert die Globalisierung ein immenses Angebot an Gütern, während die Kommerzialisierung überkommene Einrichtungen sozialer Zusammengehörigkeit auflöst. Die Konturen persönlicher und sozialer Identität verschwimmen. Johann Wolfgang Goethe, der den Begriff der Weltkultur ersann, hatte sich darunter etwas anders vorgestellt als die Allgegenwart von Adidas und Armani.
Wenn der Börsenwert des Internetbuchhändlers Amazon im Dezember 1998 doppelt so hoch war wie die Gesamtkapitalisierung der russischen Börse, dann ist dies für Manuel Castells dementsprechend Zeichen einer aus den Fugen geratenen Wirtschaftsordnung. Nach Paul Volcker, George Soros, Jeff Faux und Larry Mishel sind multilaterale Institutionen dieser Herausforderung nicht gewachsen. Durch die Globalisierung wandern nach Einschätzung von Randana Shiva "die Ressourcen von den Armen zu den Reichen, während umgekehrt die Umweltverschmutzung von den Reichen auf die Armen verlagert wird". Robert Kuttner fordert angesichts der Ungleichgewichte der Finanzmärkte eine neue weltwirtschaftliche Rahmenvereinbarung nach Vorbild von Bretton Woods.
Der zweite Themenkreis des Bandes bezieht sich auf Auswirkungen der Globalisierung auf das Leben von Familien und Einzelpersonen. Arlie Hochschild schildert die Auswirkungen der Migration von Frauen aus Entwicklungsländern, die ihre eigenen Familien zurücklassen und sich in reichen Ländern als Haushälterinnen verdingen. Ulrich Beck vermerkt, daß die Unübersichtlichkeit der Globalisierung die individuelle Lebensplanung gesteigerten Risiken aussetzt. Richard Sennett beschreibt in einem sensiblen Aufsatz, wie die Globalisierung die persönliche Identifizierung mit der Umwelt auflöst: Einst waren die Patrizier aus Hamburg oder Boston stolz auf ihre Stadt und schmückten sie mit philantropischen Einrichtungen; die heutigen Topmanager indes leben aus dem Koffer und schlagen nirgendwo Wurzeln.
Seit dem ersten Erscheinen dieses Buches hat sich der Globus oft gedreht. Daher erscheinen gerade jene Aufsätze bemerkenswert, welche ihrer Zeit voraus waren. Dazu gehört Paul Volckers Klarstellung, daß die Korruption nicht nur in Entwicklungsländern vorkommt: In den achtziger Jahren verspielte das texanische Bankwesen durch dubiose Machenschaften sein gesamtes Kapital. Schade, daß die Vorstände der texanischen Enron diesen Aufsatz nicht beherzigt haben.
BENEDIKT KOEHLER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
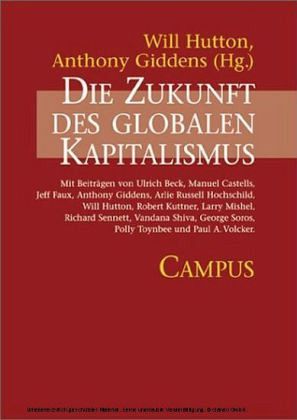




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.07.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.07.2002