älterer Mann und ein dreizehnjähriges Mädchen, die in einer Absteige freigelegt wurden. Das Mädchen hielt einen Holzkasten umklammert, in dem sich ein goldener Armreif in Schlangenform fand. Die eingravierte Inschrift "dominus suae ancillae" (der Herr seiner Ancilla) wurde zur eigentlichen Sensation. In ihr sahen die Archäologen einen Liebeslohn und damit den Beweis für die römische Dekadenz - die legitime Notzucht Reicher nicht nur an ihren erwachsenen Sklaven, sondern sogar an versklavten Kindern.
Nicht die Tatsache, dass man in Murecine einige der bisher schönsten Fresken der römischen Antike fand, und auch nicht die unerhörte Sturheit, mit der die Straßenbaubehörden darauf bestanden, das Areal nach Bergung der Wandgemälde zugunsten neuer Fahrbahnen zuzuschütten, alarmierte die Weltöffentlichkeit - es war das gemutmaßte Schicksal der Kindgeliebten Ancilla, dem alle Aufmerksamkeit galt. War sie verhätschelt worden? Oder sollte der kostbare Armreif sie mundtot machen? Wie alt war sie, als der Dominus sie erstmals in sein Bett befahl? Die Spekulationen hierüber überstrahlten selbst die kleine Claudia Augusta, die Tochter des Nero und der Poppaea, deren Bildnis eine Archäologin auf einem der Fresken von Murecine erkannte. Dargestellt ist die Kleine, die zur "übermenschlichen Trauer" des Kaisers Nero schon vier Monate nach ihrer Geburt starb, als vergöttlichtes Kind, das, selbst wunderschön, die Robe der Liebes- und Schönheitsgöttin Venus ordnet.
Wo man Säuglinge aussetzte, dort versorgte man sich mit Sklaven.
Heute (sofern sie nicht gerade auf einer der notorischen Wanderausstellungen pompejanischer Kunst unterwegs ist) zählt Claudia Augusta im Nationalmuseum Neapel zu den Höhepunkten einer Reihe von liebevollen, kostbaren Kinderporträts, die man in den Villen Pompejis freigelegt hat; verschmitzte Knaben, die als Merkur posieren, Mädchen im Kostüm der Psyche. Diese Bildnisse, dazu Kinderkritzeleien von den Wänden der Vesuvstadt oder einige Spielzeuge bezeugen zumindest für die Kinder der Oberschicht ein Heranwachsen, das dem unserer Kinder nicht unähnlich gewesen sein dürfte. Das bestätigen auch Funde aus anderen griechischen und römischen Städten, dazu Vasenmalereien, Statuen und Grabmäler, Chroniken und Mythen.
Doch der Schein trügt, wie viele Erläuterungen zu den Bildern in Annika Backe-Dahmens Buch zeigen. All die antiken Kinderdarstellungen aus Griechenland und Rom, die wir gerührt in Museen betrachten, suggerieren die Ausnahmen als Regel. Fürstensöhne und gelegentlich sogar -töchter Athens oder Roms genossen wohl jene sorgfältig zwischen musischen und athletischen Bereichen ausgleichende Erziehung, wie sie der Mythos des Achill oder die Biographien der kaiserlichen römischen Kinder überliefern. Das gilt abgeschwächt auch für die Kinder der Oberschicht. Die Überzahl aber wuchs in einer Umwelt auf, in der Kinderarbeit eine Selbstverständlichkeit war, freies Spiel oder geregeltes Lernen aber Ausnahmen.
Zwischen der kleinen Ancilla, die die Gemüter vor einigen Jahren so bewegte, und der vergöttlichten Claudia spannt sich der Bogen dessen, was Kindheit in der Antike hieß. Schon die Geburt stellte ein Risiko dar. Nicht nur in medizinischer Hinsicht, sondern auch, weil allein der Familienvater darüber entschied, ob das Neugeborene angenommen oder getötet wurde. Die Aussetzung, wie sie für römische Verhältnisse belegt ist, spricht nur bedingt für humanere Verhältnisse. Denn die Orte, wo man Säuglinge niederlegte, waren allgemein bekannt und wurden selten zur Rettung, oft aber zur Versorgung mit künftigen Sklaven aufgesucht.
Was die anerkannten Kinder angeht, lässt sich schwer zwischen Elternliebe und dem Wunsch nach Erben sowie Altersvorsorge unterscheiden. So oder so - waren die Nachkommen legitimiert, tat die Familie alles für ihr Wohl, stellte Ammen und Erzieher, behängte die Kinder zum Schutz vor Krankheiten mit Amuletten, engagierte Ärzte und Magier. Athen und Rom unterteilten die Kindheit in verschiedene, genau festgelegte Stadien, deren Ende als Übertritt ins Erwachsenenalter zelebriert wurde. Doch das galt nur für die männlichen Erben. War ein Mädchen zur Frau geworden, blieb es unter der Vormundschaft des Vaters oder wechselte in die ihres Ehemanns - wegen "der Schwäche und des Leichtsinns ihres Geschlechts" laut römischem Gesetz.
Rituale, allgemeine Überlebens- und Sachzwänge samt den Egoismen der Eltern, so zeigt Annika Backe-Dahmen, machten Kinder zum häufig geliebten, oft auch nur geduldeten, immer aber rechtlosen Spielball der Erwachsenenwelten. Und selbst dies gilt nur für die Nachkommenschaft der Reichen und der einigermaßen Begüterten. Wie das Kinderleben in den Unterschichten und bei Sklaven verlief, daüber sind kaum Einzelheiten bekannt. Es dürfte sich nicht wesentlich von dem der heutigen Kinder in den Elendsvierteln von São Paulo oder Kalkutta unterschieden haben.
Annika Backe-Dahmen: "Die Welt der Kinder in der Antike". Philipp von Zabern Verlag, Mainz 2008. 152 S., 70 Farb- u. 27 s/w-Abb., geb., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main




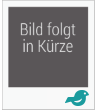

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.11.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.11.2008