entpuppt sich als exilierter Russe, der dem Pianisten ein Chopin-Autograph verschaffen will. Er bietet eine Coda der vierten Ballade (in f-Moll, op. 52) an. Chopin, so geht die Erfindung, soll diese neue, wilde Passage für Solange Dudevant, George Sands Tochter, geschrieben haben.
Natürlich ist dieses Autograph auf verschlungenen Wegen gewandert, von Paris nach Berlin, dann 1945 von Berlin nach Moskau und schließlich wieder, über den Exil-Russen, nach Paris zurück. Natürlich stehen am Rande dieses Wegs allerhand historische Figuren, nicht nur George Sand und ihre Tochter Solange, sondern auch Delacroix Fontana, der Freund, und Clésinger, Solanges Mann, der Chopin die Totenmaske abnahm. Am Ende bekommt der Pianist das Autograph. Und natürlich geht das Spiel mit der Kolportage am Ende so weit, daß man auch den Pianisten zu erkennen glaubt: Der fiktive Autor, der mit und über Arrau, Horowitz, Rubinstein, Gould und Toscanini wie zu Pairs und über Pairs redet, dieser Mann kann nur Arturo Benedetti Michelangeli sein. Erinnert der Erzähler nicht selbst an eine Einspielung, die jeden Klavierfreund erschauern läßt, an die zehn Mazurken, darunter die allerletzte, auch sie in f-Moll (op. 68, Nummer 4)?
Dieser Roman hat viele Vorzüge: Er ist kultiviert, ohne akademisch zu sein, aber auch spannend, kriminalistisch geradezu, obwohl ein Verbrechen gar nicht vorliegt; er ist bewegend, und der Humor fehlt auch nicht. Schließlich lernt man sogar aus ihm. Doch über eine Unklarheit kommt der Leser nicht hinweg: Warum läßt Cotroneo den, der hier schreibt, überhaupt schreiben? Warum und zu welchem Ende teilt dieser alte, müde Pianist sich so intensiv mit? Und wem? Eine Antwort auf diese Fragen fehlt um so mehr, als es Cotroneo in der Montage seiner raffinierten Fiktion mit der Realität an allen anderen Stellen mühelos gelingt, Plausibilität zu erreichen. So leuchtet alles ein. Nur dieses eine nicht: Warum schreibt gerade dieser Mann?
An manchen Stellen wird der Roman etwas seicht und klischeehaft, zum Beispiel wenn Franz Werth, der Nazi-Pianist, der sich in SS-Uniform für kleine Zirkel ans Klavier setzt, am Ende nach Chile flieht und dort verkommt. Aber etwas Kühnes und Modernes wollte Cotroneo gewiß nicht schreiben, bloß ein flottes, postmodernes Buch, das drei Welten eindrucksvoll zusammenbringt: die des Klaviers, jenes ungeheuer kompletten Instruments, das ganz und gar fertig, abrufbar, abtastbar vor uns steht, dann die Welt des alten, müden, skrupulösen Pianisten, der alles kann und obsessiv doch wieder und wieder verzagt, und schließlich die Welt Chopins, des Romantikers mit den "tragischen Progressionen aus artistischer Überzeugung", wie Gottfried Benn sie hörte.
Zwei Einwände noch gegen den deutschen Titel. Erstens hätte man den schönen, ebenso offenen wie genauen italienischen Titel "Presto con fuoco" ruhig stehenlassen können. Zweitens und wichtiger: Es geht in diesem Buch nicht um eine "Partitur". Partituren gibt es bei Opern und Symphonien, nicht aber bei einer Klavierkomposition. HANS-MARTIN GAUGER
Roberto Cotroneo: "Die verlorene Partitur". Roman. Aus dem Italienischen übersetzt von Burkhart Kroeber. Insel Verlag, Frankfurt am Main 1997. 280 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
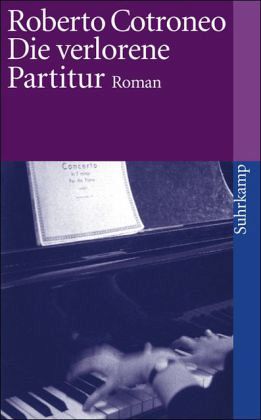




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.02.1998
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.02.1998