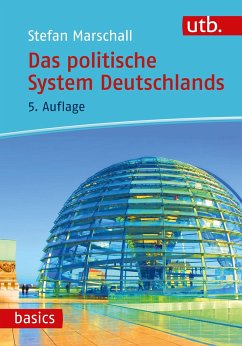zwar gelegentlich ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts öffentlich als "falsch" bezeichnet. Er hat sich aber gehütet, es zu übergehen. Der selbstverständliche Respekt, mit dem alle Staatsorgane der Verfassung und dem Verfassungsgericht begegnen, ist vielleicht der deutlichste Ausweis des Erfolges jener deutschen Verfassung, die sich so bescheiden "Grundgesetz" nennt. Wie genau dieser Erfolg zustande gekommen ist, auch das ist schwer zu erklären. Die relative Beschaulichkeit der fünfzig deutschen Nachkriegsjahre, die ökonomische Prosperität, die polititsche Stabilität - all das wurde von der Verfassung ermöglicht und beschirmt, trug aber umgekehrt wohl auch zu ihrer erstaunlichen Blüte bei.
So vielfältig die Faktoren des Erfolges sind, so unübersichtlich sind die Gefahren, die ihn bedrohen. Mag die Verfassung derzeit auch unangefochten und populär sein: die in langen Jahren gewachsene Stabilität ist nicht notwendig von Dauer, die Erfolgsgeschichte des Grundgesetzes nicht unbedingt ein Fortsetzungsroman. Was erreicht worden ist, muß gepflegt und den sich permanent wandelnden Verhältnissen angepaßt werden. Dazu gehört es fast unausweichlich, neue Probleme möglichst frühzeitig zu erkennen, Erosionsprozessen vorzubeugen, ehe sie die Fundamente der Verfassung unterhöhlen. In seiner jetzt publizierten Aufsatzsammlung "Die Verfassung und die Politik" betreibt Dieter Grimm, ehedem Richter am Bundesverfassungsgericht, seit Dienstag Rektor des Wissenschaftskollegs zu Berlin, eben das: Wie mit einem sehr sensiblen Instrument untersucht er die Verfassung der Republik, um Mißbildungen aufzufinden und Therapievorschläge zu machen. Und Grimm wird fündig.
Er scheut sich nicht, Unerfreuliches auszusprechen. Europa sei - mangels einer gemeinsamen Sprache und einer europäischen Öffentlichkeit - nicht reif für eine Verfassung. Der real existierende Föderalismus der Bundesrepublik habe sich, durchaus anders als von den Verfassungsautoren intendiert, "in ein bundespolitisches Blockadeinstrument" verwandelt, das die allgemeine "Politikunlust" befördere. Überfrachtete Verfassungsvorschriften wie der ins Absurde novellierte Asylartikel drohten das Grundgesetz zu "verderben". Und zu den Toleranzgrenzen der Verfassung schreibt Grimm, nach den Anschlägen in Amerika beklemmend aktuell, die Gesellschaft sei nicht gezwungen, zur Anerkennung fremder kultureller Identität die eigene aufzugeben: "Nicht alle Kulturkonflikte lassen sich harmonisch lösen." Was sich dieser Tage beinahe bellizistisch liest, ist so drastisch allerdings gar nicht gemeint. Gelegentlich bleibe nur die "Alternative von Anpassung oder Wegzug", zivilisiert Grimm das dramatisch Klingende sogleich wieder.
Da seine Aufsatzsammlung den Untertitel "Einsprüche in Störfällen" trägt, finden sich auch Bemerkungen zu den Deformationen des Parteienstaats, dessen Wucherungen alle Gewaltenteilungsregeln auszuhebeln drohen. Auf diese Deformationen reagiert Grimm aber nicht mit Appellen an die Moral. Seine Hoffnung gilt nicht der höheren Einsicht der Politik, sondern dem Procedere. Er will die auf Machterwerb und Machterhalt spezialisierten Akteure nicht zu besseren Menschen machen, er will die Verfahren verbessern. Daß Grimm als Gegengewicht zur Übermacht der Parteien beispielsweise die Einführung plebiszitärer Elemente in die Verfassung mindestens bedenkenswert findet, ihnen jedenfalls nicht mit der tiefsitzenden Skepsis der deutschen Staatsrechtslehre begegnet, ist bekannt. Er hat gelegentlich vorgeschlagen, künftig alle Verfassungsänderungen dem Souverän zur Entscheidung vorzulegen. Und er bedauert es bis heute, daß nach der Vereinigung die Chance vertan wurde, ein überarbeitetes Grundgesetz mittels einer Volksabstimmung auch im Osten der Republik in die Köpfe, vielleicht gar in die Herzen der Menschen einzusenken. "Für eine auf Integration der beiden Landesteile angewiesene Gesellschaft", so Grimm, sei dieses Versäumnis "eine schwere Hypothek."
Bedrohlicher noch als diese Belastung, die fast schon wieder hinter dem Grauschleier der neuesten Rechtsgeschichte verschwunden ist, erscheint in Grimms Darstellung eine andere Entwicklung, die das herkömmliche Staatsverständnis grundstürzend verändern könnte. Warnend spricht Grimm von einer Schwächung der Verfassung, von ihrer "Entwertung", die nicht von äußeren Mächten drohe, sondern von innen. Die Bedrohung erwachse aus der tiefgreifenden Veränderung der Staatsaufgaben und der Instrumente zu ihrer Bewältigung. Statt, wie einst vorgesehen, eine stabile gesellschaftliche Ordnung stabil zu halten, Gefahren abzuwehren und vorhandene Freiheitsräume zu schützen, also retrospektiv, punktuell und individuell zu wirken, sucht der moderne Sozialstaat vorausschauend, planend und lenkend zu agieren. Er bemüht sich, so Grimm, Störungen vorzubeugen, Freiheitsräume überhaupt erst zu schaffen, kurz, er ist von der Bewahrung der gesellschaftlichen Ordnung zu deren aktiver Gestaltung übergegangen. Diese nie umstrittene und mittlerweile ganz selbstverständliche Aufgabenverschiebung hat nun allerdings erhebliche Folgen.
Sie führt zunächst zu einem explosiven Wachstum der Staatsaufgaben - Bildungsplanung, Konjunktursteuerung, Risikovorsorge im Umweltbereich: Nichts ist seinem Zugriff mehr fremd. Mit dieser Ausweitung geht Grimm zufolge aber fast notwendig ein Verlust an Durchsetzungskraft einher. Nicht so sehr, weil der Staat in seiner immensen Anstrengung, alles zum Guten zu regeln, seine Kräfte überspannt. Er kann vielmehr keine klaren Gebote oder Verbote mehr erlassen, sondern muß sich darauf beschränken, Ziele zu beschreiben und Vorschläge zu deren Erreichung zu machen: Schließlich läßt sich ein Konjunkturaufschwung nicht verordnen. Das Gesetz wandelt sich vom "klassischen Konditionalprogramm" zum "Finalprogramm" mit der Folge, daß viele Entscheidungen dem Ermessen der Verwaltung überlassen bleiben, was zu einer Einbuße an gerichtlichen Überprüfungsmöglichkeiten führt.
Eine weitere Folge des unbekümmerten Ausgriffs in nahezu alle Lebensbereiche ist für Grimm die Entstehung neuer Abhängigkeiten. Der Staat, der sich recht eigentlich durch seine unumschränkte Macht auszeichnet, "wird bei der Verfolgung des Gemeinwohls von der Folgebereitschaft partikularer Interessen abhängig", die für ihre Zustimmung "staatliche Konzessionen" fordern können - und dies auch unbekümmert tun. Anders gesagt: Der Staat verfügt nicht mehr über alle Ressourcen, die er braucht, um seine Ziele zu erreichen, und muß sich daher auf Verhandlungen mit mächtigen Interessengruppen einlassen. Daß dies beileibe kein theoretisches Problem ist, hat der sogenannte Atomkonsens abschreckend deutlich gemacht. Grimm spricht plastisch vom "paktierenden Staat", den er voller Skepsis betrachtet, weil er die Demokratiedefizite all der Bündnisse sieht, in denen abseits der vorgeschriebenen Prozeduren Entscheidungen von Delegationen gefällt werden, die sich nie in Wahlen für ihr Handeln legitimieren müssen.
Wie diesen Entwicklungen zu begegnen ist, wie die neuen Probleme verfassungsrechtlich eingehegt werden könnten, vermag auch Grimm nicht zu sagen. Immerhin aber wendet er sie souverän hin und her, beleuchtet seine Gegenstände aus unterschiedlichen Perspektiven, kennt und erwähnt die Einwände, um sie meist überzeugend zu widerlegen. Er findet dabei klare, entschiedene, teils brillante Formulierungen, die sich nicht nur an den Fachkollegen wenden, sondern mehr noch an den Souverän, den Wähler. Grimms Buch ist so etwas wie eine Pflichtlektüre für Staatsbürger.
Und doch: Zweierlei vermißt man. Leider verliert Grimm kein Wort zu der vielfach kritisierten, neuerdings offenbar wachsenden Neigung des Karlsruher Gerichts, nicht nur Verfassungsverstöße zu korrigieren, sondern der Legislative penibel genaue Vorgaben für die Gesetzgebung zu machen. Diese von keiner richterlichen Zurückhaltung mehr gebremste, bisweilen freilich von Parlament und Regierung geradezu provozierte Anmaßung - besonders augenfällig in der Rechtsprechung zur Vermögenssteuer - fällt genau in das Spannungsfeld von Verfassung und Politik, das Grimm in seinen Aufsätzen immer wieder umkreist und durchwandert. Warum er ausgerechnet vor der heiklen Frage der Selbstüberhöhung Karlsruhes zum Reservegesetzgeber oder, wie gelegentlich formuliert wurde, zur "Richtlinieninstanz für die Gesetzgebung" haltmacht, läßt sich kaum verstehen. Sein Schweigen ist um so ärgerlicher, als ein differenziert argumentierender Autor wie Grimm gewiß auch zum Streit um die Kompetenzausdehnung Karlsruhes Erhellendes hätte beitragen können. Da er es aber versäumt, die Regelungswut zu erklären, die seine Kollegen gelegentlich befällt, schleicht sich der Verdacht ein, hier habe ein ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichts die eigene Institution, auf die er mit so großem Recht so stolz ist, nicht mit derselben unerbittlichen Schärfe in den Blick genommen wie die Politik.
Der zweite Mangel ist leichter zu ertragen, bleibt aber bedauerlich. Es ist die völlige Abwesenheit von Pathos. Selbst in den Artikeln für Festschriften und in seinen Jubiläumsvorträgen verbietet sich Grimm jeden hohen Ton. Gewiß, er bescheinigt dem Grundgesetz "breite Wertschätzung" sowie eine tiefe Verwurzelung im öffentlichen Bewußtsein und stellt - beinahe staunend - fest, die Verfassung sei, jedenfalls in der alten Bundesrepublik, in Ermangelung nationaler Anknüpfungspunkte ein "Nationsersatz" geworden. Zu Begeisterungsstürmen vermag das Grimm jedoch nicht hinzureißen. Sogar sein Beitrag zum fünfzigsten Geburtstag des Grundgesetzes, der das Buch als "Bilanz" und Ausblick beschließt, ist eher von der Sorge um künftige Gefährdungen der Verfassung geprägt als von Befriedigung über das Vollbrachte. Das Äußerste, das Grimm sich abzuringen vermag, ist die Feststellung, beim Grundgesetz handele es sich um eine "relevante" Verfassung, um eine also, die "Beachtung" findet.
Diese Nüchternheit erwächst wohl aus der historischen Erfahrung, daß auch eine "gute" Konstitution wie die Weimarer Reichsverfassung tragisch scheitern kann, und sie wird von dem Wissen um das Fragile jener Voraussetzungen bestärkt, die jede Verfassung zu ihrem Gelingen braucht, ohne sie selbst garantieren zu können. Und doch wünschte man sich, daß Grimm die Zuneigung, ja spröde Liebe zum Grundgesetz, die all seinen Aufsätzen unterlegt ist, auch einmal in halbwegs überschwengliche Worte fassen würde. Eine derart geglückte und glückliche Verfassung wie das Grundgesetz hätte eine solche Lobpreisung mitunter verdient.
HEINRICH WEFING
Dieter Grimm: "Die Verfassung und die Politik". Einsprüche in Störfällen. Verlag C.H. Beck, München 2001. 336 S., br., 38,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main







 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.10.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.10.2001