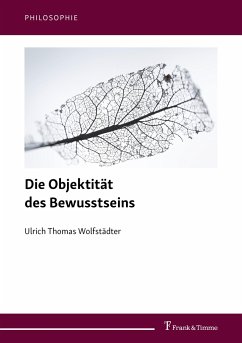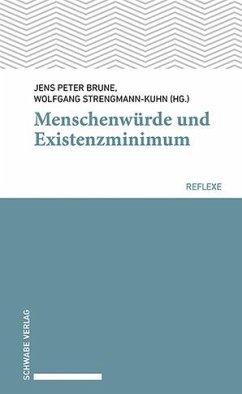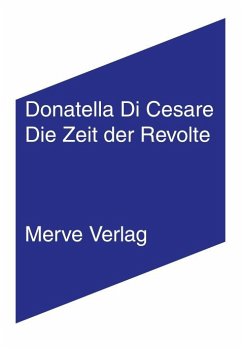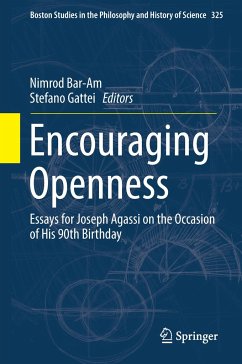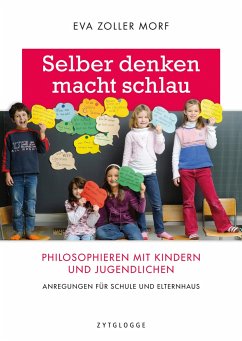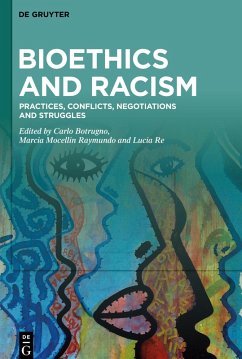meritokratischen Prinzipien erlesenen Scientific Community nun jedoch nicht um die universitäre Wirklichkeit der Gegenwart handelt, kann wohl auch wenig Erstaunen provozieren, sehen sich doch die je individuellen Voraussetzungen und Chancen, an dieser wissenschaftsinternen Bestenauslese teilzunehmen, einer ebenso ungleichen Verteilung ausgesetzt.
Bildungsinstitutionen - das gilt für die Schule in gleichem Maße wie für die Universität - wollen ihrem eigenen Selbstverständnis und Anspruch nach an den nicht nur ungleichen, sondern vielfach eben auch ungerechten Selektions- und Ausschlussverfahren sozialer Stratifizierung nicht teilhaben, sie nicht nachahmen und reproduzieren, sie stattdessen im besten Falle sogar außer Kraft setzen. Doch die heutige Universität verhält sich gesellschaftlichen Diskriminierungsformen gegenüber nicht lediglich indifferent, sie arbeitet ihnen zu, verstärkt sie und bringt sie dadurch nochmals neu hervor. Das zumindest ist die These, die eine jüngst erschienene Streitschrift von Sabine Hark und Johanna Hofbauer antreibt. Die Universität in diesem Verständnis erscheint als eine "ungleichheitsgenerierende Institution".
Für die Fortdauer solcher Ungleichheiten werden jenseits historisch bedingter Ausschlüsse vor allem zwei gegenwärtige Entwicklungen identifiziert. Zum einen die anhaltende Ökonomisierung universitärer Bildung, die Durchsetzung des "Prinzip[s] Wettbewerb" als "zunehmender Modus hochschulischer Transformation", der nach innen und nach außen entsichernd wirke. Zum andern die in den vergangenen Monaten vom akademischen Mittelbau öffentlich skandalisierte Befristungspraxis im deutschsprachigen Hochschulwesen.
Auch wenn andere Phänomene hier und da gestreift werden (was wird gelesen, oder wem steht welches Visum zu?), interessieren sich die Autoren vor allem für die Universität in ihrer Rolle als Arbeitgeberin in Deutschland und Österreich, die eine wissenschaftliche Karriere für einige wenige ermöglicht. An diesen Stellen schafft der Text einen überzeugenden Anschluss an die wissenschaftspolitischen Debatten der vergangenen Monate: Von den durch die gegenwärtigen Arbeitsbedingungen erzeugten Risiken, Ängsten und Unsicherheiten sind nicht alle gleichermaßen betroffen.
Als "Gleichstellungsparadox" umschreiben Hark und Hofbauer den Umstand, dass etliche Universitäten die Bekämpfung solcher Ungleichheiten längst auf die eigene Agenda geschrieben haben, ein Bewusstsein für die Problemlage aufseiten der Hochschulen daher nur schwer geleugnet werden kann. Woran es eben nicht mangelt sind Stellungnahmen von Universitätsleitungen, Lage- und Tätigkeitsberichte beständig neu eingerichteter Diversity-Stellen, geduldige Selbstverpflichtungen sowie, so lässt sich mit Blick auf das nicht gerade knappe Literaturverzeichnis des schmalen Bandes ergänzen, empirische Forschung zum Thema.
Dieser Analyse gegenüber eher widersprüchlich wirkt die Forderung nach noch "mehr und bessere[n] Analysen" zu den durch Rassismus, Sexismus oder soziale Herkunft erzeugten Ungleichbehandlungen an der Hochschule, wird doch damit gerade die Wiederholung jenes "gleichstellungspolitisch paradoxe[n] Musters von Reden versus Tun" heraufbeschworen, auf das zuvor noch kritisch Bezug genommen wurde und das sich häufig in der "Erstellung von Schriftstücken" erschöpft.
Welche konkreten und genuin universitären - im Chemielabor sicherlich andere als im geisteswissenschaftlichen Kolloquium - Praktiken zukünftig auf dem Weg hin zu einer inklusiveren Institution eine Veränderung erfahren könnten, hätte an vielen Stellen noch stärker fokussiert werden können, da die häufig bemühten herrschaftskritischen Großbegriffe den Eigensinn der behaupteten akademischen Ausschlussmechanismen manchmal eher verdecken als näher erhellen.
Die so aufgeworfene und kurz zum Ende hin gestreifte Frage danach, "wie die Universität zu retten ist", wird von Hark und Hofbauer dann weitestgehend unbeantwortet gelassen. Aus der Allgemeinheit, in der abschließend an die institutionelle Reform der "politischen und rechtlichen, aber auch [...] sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen" appelliert und auf die Veränderung der subjektiven "Überzeugungen und Einstellungen der Einzelnen in Bezug auf die Unter- oder Überlegenheit anderer" gehofft wird, spricht wohl eher die Unklarheit, an welchen politischen Adressaten die ja zu Recht formulierte Forderung nach einer "Universität der vielen" sich richten soll. TOBIAS SCHWEITZER
Sabine Hark und Johanna Hofbauer: "Die ungleiche Universität". Diversität, Exzellenz und Anti-Diskriminierung.
Passagen Verlag, Wien 2023. 176 S., br., 23,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.12.2023
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.12.2023