Einschätzung, dass die verheerenden Flächenangriffe einen entscheidenden Beitrag für den Sieg leisteten. Grayling will diese Rechtfertigung widerlegen und legt seine Darstellung wie in einem Gerichtsverfahren an. Im ersten Drittel schildert er die Geschichte des Bombenkrieges, wie man sie aus vielen anderen Darstellungen kennt. Er schildert sodann die Erfahrungen der Bombardierten. Der skandalträchtigen Schilderung von Jörg Friedrich, deren Übersetzung in England für Empörung sorgte, stimmt er zwar ausdrücklich zu, will sich in seinem Buch aber ausdrücklich nur auf englische Literatur beziehen.
Im zweiten Teil präsentiert er ausführlich die Vordenker und Strategen des britischen Bombenkrieges sowie die "Stimmen des Gewissens". Dabei wägt er sorgfältig und fair die Argumente beider Seiten ab, hält aber die Rechtfertigung von Arthur Harris, dem damaligen Chef des Bomber Command, für nicht stichhaltig. Dieser blieb trotz aller Rückschläge und Zweifel fest davon überzeugt, dass seine Methode des unterschiedslosen Flächenbombardements gegen die Zivilbevölkerung eine zwar brutale, aber wirksame Methode sei, den Krieg schneller zu beenden und blutige Bodenkämpfe wie im Ersten Weltkrieg zu verhindern. Bis an die Grenze der Befehlsverweigerung setzte er seine Strategie immer wieder durch, ein eiskalter Technokrat, der seine Chancen nutzte, die eine halbherzige politische Führung ihm ließ.
Nun hat der strategische Bombenkrieg insgesamt tatsächlich einen wichtigen Beitrag zum alliierten Sieg geleistet, wenn auch Nutzen und Ergebnis der speziellen britischen Methode zweifelhaft waren und sind. In der öffentlichen Auseinandersetzung verwischen sich leicht die verschiedenen Ebenen, so wie Grayling zwar immer wieder beteuert, es gehe ihm lediglich darum, die Flächenangriffe zu brandmarken, sein Buch wirbt aber im Untertitel mit der missverständlichen Frage, ob die alliierten Bombenangriffe ein Verbrechen gewesen seien. Für den Autor ist aber eindeutig, dass die Alliierten einen gerechten Krieg geführt haben und der Bombenhagel auf militärisch sowie wirtschaftlich bedeutsame Ziele insofern sinnvoll und richtig gewesen ist. Diese Präzisionsangriffe, eine Spezialität vor allem der Amerikaner, verschonten freilich nicht Städte und Zivilbevölkerung: Kollateralschäden, wie man heute sagen würde, die immerhin die Hälfte der deutschen Luftkriegsopfer ausmachten. Wenn der Philosoph also meint, die Methode von Flächenangriffen, die sich gezielt gegen die deutsche Bevölkerung richteten, um durch Terror und Vernichtung die "Moral" der Deutschen zu zerbrechen, sei verwerflich und nutzlos gewesen, dann folgt er nicht einer pazifistischen Linie.
Im letzten Teil formuliert er seine Anklage lediglich gegen die Flächenoffensive. Er bemüht dazu die Theorie des gerechten Krieges und das Kriegsvölkerrecht, um zu begründen, dass die Terrorangriffe, auch von den Amerikanern 1945 gegen Japan praktiziert, ein Verbrechen im moralischen Sinne und eklatante Verstöße gegen das Sittengesetz gewesen seien. Es folgt das Urteil: Ein schweres Unrecht, das den Verantwortlichen auch bewusst gewesen sei. Sie hätten ihre Taten vorsätzlich begangen, die Berufung auf Notwehr und Kriegsnotwendigkeiten sei nicht überzeugend. Dass die Täter in diesem Falle moralisch genauso tief gesunken sind wie ihre Gegner, sollte heute "inständig und offen bereut werden". Man mag darin Balsam für die auch nach sechzig Jahren noch verletzte deutsche Seele erkennen. Doch Graylings Schlussfolgerungen können nicht alle überzeugen. Seine Gleichsetzung von Hamburg (1943), Hiroshima (1945) und New York (2001) wirkt allzu unhistorisch, und das Beispiel Hamburg dürfte wenig hilfreich sein, wenn heute Politiker oder einzelne Soldaten und Polizisten in einer unübersichtlichen Situation Entscheidungen über den Einsatz von Gewalt treffen müssen. Die ethischen Grundlagen können nur Richtschnur sein, die Gewissensnot des Handelnden wird bleiben. Nachträglich wird man immer leichter urteilen. Die sehr gut lesbaren und interessanten Überlegungen des Philosophen verdienen gleichwohl Beachtung.
ROLF-DIETER MÜLLER.
A. C. Grayling: Die toten Städte. Waren die alliierten Bombenangriffe Kriegsverbrechen? C. Bertelsmann Verlag, München 2007. 413 S., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
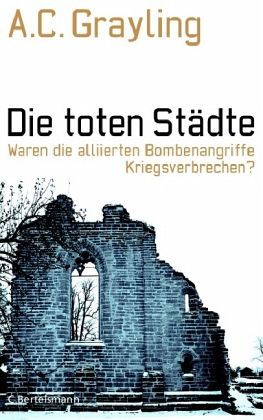




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.08.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.08.2007