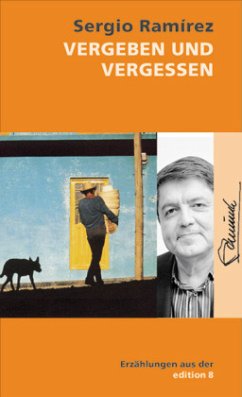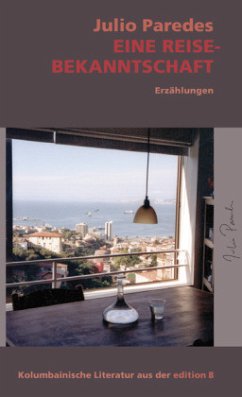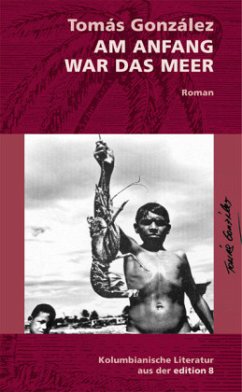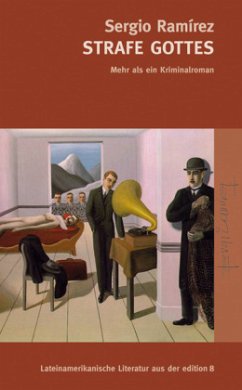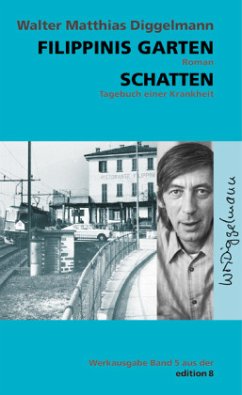Die Teufelspferdchen
Roman. Ungekürzte Ausgabe
Übersetzung: Schultze-Kraft, Peter; Schultze-Kraft, Ofelia
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
22,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Protagonist dieses Romans hat keinen Namen. Er wird 'der, der sich zwischen den Pflanzen verliert' genannt. Wir kennen ihn bereits aus Tomás González' früher erschienenen Romanen: In Horacios Geschichte ist er noch ein Jugendlicher, einer von Álvaros Söhnen, Jerónimo Guillermos Vetter, J.s und Davids Bruder und wird als 'der,der etwas von Bäumen verstand' vorgestellt. In Am Anfang war das Meer ist er der 'Verwandte', von dem sich J. um seine Erbschaft betrogen fühlt und der am Ende J.s Beerdigung effizient und herzlos in die Hand nimmt.Der Roman beschreibt, wie der Protagonist eine...
Der Protagonist dieses Romans hat keinen Namen. Er wird 'der, der sich zwischen den Pflanzen verliert' genannt. Wir kennen ihn bereits aus Tomás González' früher erschienenen Romanen: In Horacios Geschichte ist er noch ein Jugendlicher, einer von Álvaros Söhnen, Jerónimo Guillermos Vetter, J.s und Davids Bruder und wird als 'der,der etwas von Bäumen verstand' vorgestellt. In Am Anfang war das Meer ist er der 'Verwandte', von dem sich J. um seine Erbschaft betrogen fühlt und der am Ende J.s Beerdigung effizient und herzlos in die Hand nimmt.Der Roman beschreibt, wie der Protagonist eine Finca am Rand der Grossstadt Medellín erwirbt und bewirtschaftet. Diese Bewirtschaftung - ein kontinuierlicher Ausbau und eine ständige Verschönerung des kleinen Landguts -, die er und seine Frau Pilar mit eigenen Händen betreiben, führt die beiden in eine immer grössere Einsamkeit. Es ist ein vielschichtiger, tiefgründiger, geheimnisvoller Roman, das Charakterbild eines Mannes, der - vor einer Schuld fliehend? - sich zunehmend von der Welt abkapselt und von der Vegetation, die er selbst hervorbringt, schlucken lässt. Mit der Finca schafft sich der Protagonist durch unermüdliche Arbeit ein von der verpesteten, habgierigen, gewalttätigen Aussenwelt abgenabeltes Mikroparadies, das zugleich eine Hölle ist, weil ein Übermass an Schönheit und Perfektion etwas Erstickendes hat und weil er sich selbst nicht entfliehen kann. Neben dem Protagonisten und seiner Frau werden mehrereFamilienangehörige - unter anderen J. als junger Heisssporn in Medellín und David,das alter ego des Autors - und viele Nebenfiguren lebendig. Kurz gesagt: Das Buch ist die spannende, brillant erzählte Geschichte eines Scheiterns innerhalb eines Scheiterns, der persönliche Schiffbruch des Protagonisten innerhalb des Niedergangs der kolumbianischen Gesellschaft (hier aufgezeigt am Beispiel der Stadt Medellín).
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.