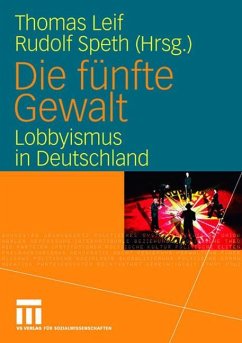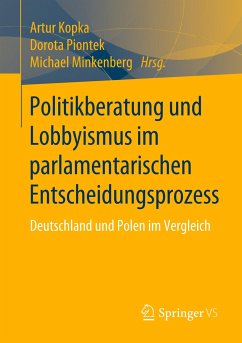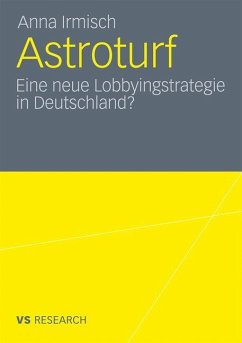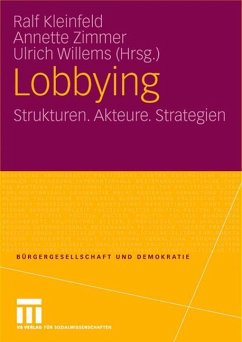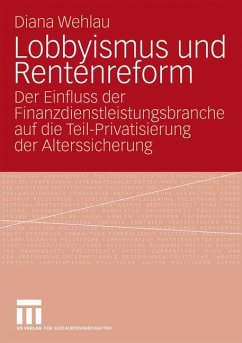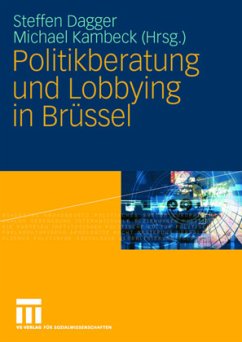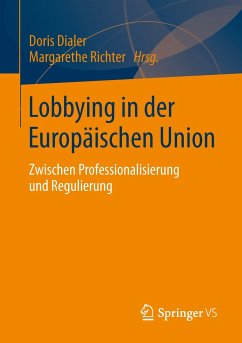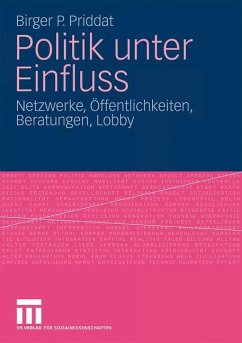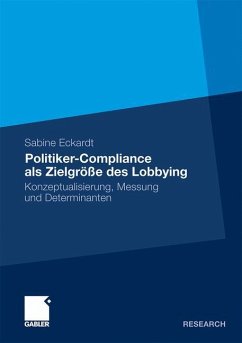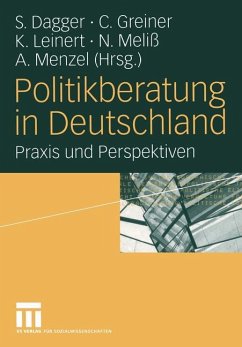Die stille Macht
Lobbyismus in Deutschland
Herausgegeben: Leif, Thomas; Speth, Rudolf

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Lobbyisten scheuen das Licht der Öffentlichkeit, gewinnen in der Berliner Republik aber immer mehr an politischem Einfluss. Dennoch wird die "stille Macht" Lobbyismus von der Wissenschaft, den Medien und der Öffentlichkeit selten in seinem gesamten Machtspektrum gewürdigt. In diesem Buch wird der Lobbyismus umfassend analysiert und der ständig wachsende Einflussbereich von Wirtschaft auf politische Entscheidungen neu vermessen. Die politische und wissenschaftliche Analyse zur aktuellen Entwicklung der politischen Lobbyarbeit wird durch neue Studien und zahlreiche Fallbeispiele etwa der Pha...
Lobbyisten scheuen das Licht der Öffentlichkeit, gewinnen in der Berliner Republik aber immer mehr an politischem Einfluss. Dennoch wird die "stille Macht" Lobbyismus von der Wissenschaft, den Medien und der Öffentlichkeit selten in seinem gesamten Machtspektrum gewürdigt. In diesem Buch wird der Lobbyismus umfassend analysiert und der ständig wachsende Einflussbereich von Wirtschaft auf politische Entscheidungen neu vermessen. Die politische und wissenschaftliche Analyse zur aktuellen Entwicklung der politischen Lobbyarbeit wird durch neue Studien und zahlreiche Fallbeispiele etwa der Pharmalobby, Straßenbaulobby und Agrarlobby ergänzt. Wichtige Lobbyisten äußern sich zu ihrer Arbeit in Berlin. Auch der mächtige, aber unkontrollierte Lobbyismus in Brüssel wird behandelt. Lobbyismus ist ein großes Tabuthema im parlamentarischen System der Bundesrepublik Deutschland. Erstmals werden unbekannte Einflusszonen aufgedeckt, die wichtigsten Akteure und ihre Machttechniken beschrieben. Die Macht der "Fünften Gewalt" wird mit diesem Buch transparenter - ein Hintergrunddossier und gleichzeitig ein wichtiges Kapitel verschwiegener Sozialkunde.