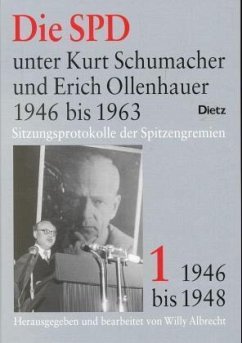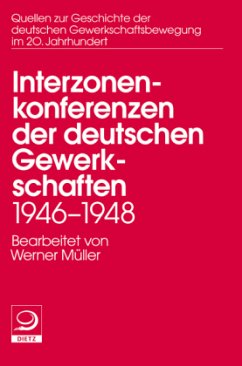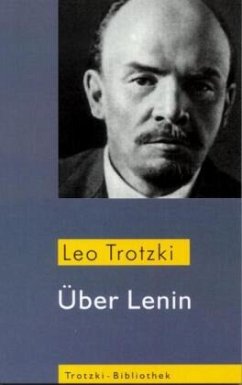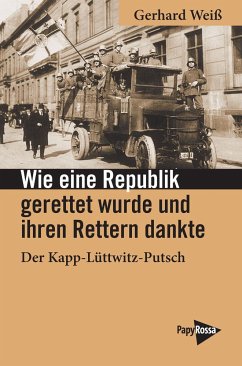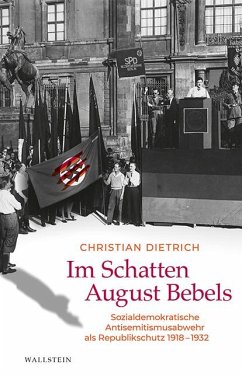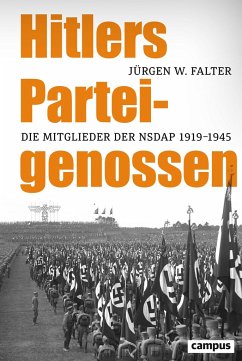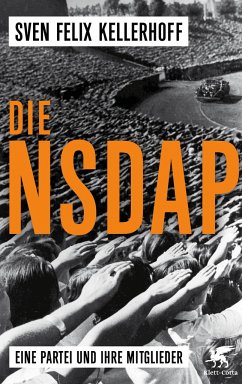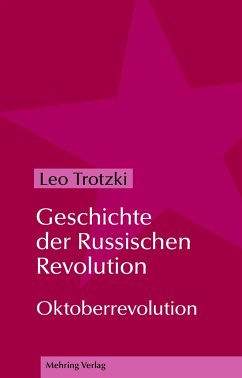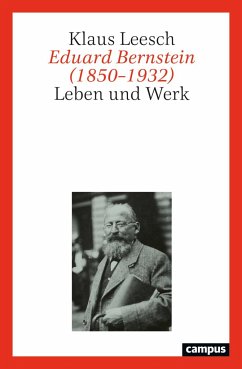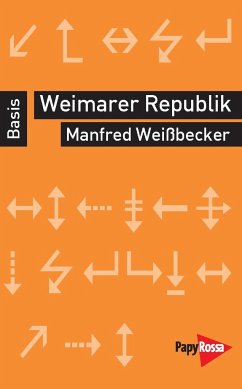auf der Agenda der Parteivorstandssitzungen: die Verabschiedung des Bonner Grundgesetzes, der folgenschwere Gang der SPD in die Opposition nach der verlorenen Bundestagswahl 1949 und der Streit um die Westintegration der Bundesrepublik.
Auch als der SPD-Vorsitzende Schumacher noch auf dem Krankenbett lag, sahen sich die Vertreter der SPD-Fraktion im Parlamentarischen Rat schon harter Kritik ausgesetzt. Gleich mehrere Parteivorstandsmitglieder wollten den vom Parlamentarischen Rat ausgearbeiteten Grundgesetzentwurf zu Grabe zu tragen, weil nach ihrem Dafürhalten die Bonner Verfassungsexperten nicht, wie vom Parteivorstand beschlossen, ein provisorisches Grundgesetz ausarbeiteten, das eine Vertiefung der deutschen Spaltung verhindern sollte, sondern ein perfektes Verfassungswerk schufen, das auf die Gründung eines westdeutschen Staates hinauslief.
Noch ungehaltener waren sie darüber, daß die Sozialdemokraten den Föderalisten in der CDU/CSU-Fraktion zu viele Zugeständnisse gemacht hatten. Der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Carlo Schmid, mahnte die Kritiker, zu denen auch der stellvertretende Parteivorsitzende Erich Ollenhauer zählte, zu mehr Verantwortungsbewußtsein. Es sei, so gab er zu bedenken, "besser, in einem mit Hypotheken belasteten Haus zu wohnen, als auf der Straße zu übernachten". Unterstützung bekam er von den populären Bürgermeistern aus Hamburg und Bremen, Brauer und Kaisen, und nicht zuletzt von Berlins Oberbürgermeister Ernst Reuter, der das Zustandekommen der Bonner Verfassung zur "Lebensfrage" für Berlin erklärte.
Die Situation im SPD-Parteivorstand spitzte sich zu, nachdem die Alliierten den Grundgesetzentwurf des Parlamentarischen Rates als zu zentralistisch abgelehnt hatten. Der wiedergenesene SPD-Parteivorsitzende setzte dem von den Alliierten verordneten Föderalismus ein hartes Nein entgegen. Der dekretierte "Hyperföderalismus" verhinderte seiner Ansicht nach den Aufbau eines lebensfähigen demokratischen Gemeinwesens und leistete einer "Infiltration des nationalen Kommunismus" Vorschub, der die "urteilslosen Massen zu faszinieren" drohte. Die führenden Sozialdemokraten teilten Schumachers Bedenken. Viele von ihnen plädierten jedoch für eine Kompromißlösung und riefen die SPD-Ratsfraktion zu "weiterem hartnäckigen Verhandeln" auf. Schumacher, der der Ratsfraktion ein "Korsett" hatte anlegen wollen, mußte auf dem kleinen Parteitag der SPD in Hannover am 20. April 1949 von seiner Politik des alles oder nichts abrücken und es hinnehmen, daß seinem Nein ein "bedingtes Ja" angeheftet wurde, das den Weg zur Verabschiedung des Grundgesetzes freigab.
In Zukunft ließ sich der SPD-Parteivorsitzende das Gesetz des Handelns nicht mehr aus der Hand reißen. Nach der verlorenen Bundestagswahl 1949 diktierte er der Partei den Gang in die Opposition. Obwohl er Schumachers Standpunkt teilte, beschwerte sich Brauer über "das Abwürgen anderer Auffassungen in der Partei durch den Vorsitzenden". Auch dem Vorsitzenden des Bezirks Westliches Westfalen, Fritz Henßler, mißfiel es, daß "Genossen von Hannover öffentlich abgekanzelt wurden". Er sprach sich für die Bildung einer großen Koalition aus, denn man könne "nicht in Bonn die CDU in Grund und Boden verdammen und gleichzeitig in den Länderregierungen zusammenarbeiten". Willy Brandt, als Vertreter Berlins in den Deutschen Bundestag gewählt, machte sich zum Fürsprecher der Menschen in der Sowjetischen Besatzungszone, indem er die Bildung einer "nationalen Notgemeinschaft" vorschlug, die von Schumacher jedoch strikt abgelehnt wurde, der nach den Erfahrungen der Weimarer Republik glaubte, daß die SPD in "keine Regierung gehen" könne, in der sie nur "mitlaufe", "statt zu gestalten". Der SPD-Vorsitzende war wie besessen von der Furcht, die SPD könne die in der Weimarer Republik gemachten Fehler wiederholen. Das erklärt die Unerbittlichkeit, mit der er seinen Standpunkt verfocht und von den "Genossen" verlangte, "den Mund zu halten", wenn die Instanzen gesprochen hatten.
Die meisten trauten sich nicht mehr, gegen den Stachel zu löcken. Eine offene Diskussion fand, wenn man den Protokollen Glauben schenken darf, im Parteivorstand immer seltener statt. Einige äußerten ihren Unmut öffentlich, wie Kaisen, der in einem Artikel in der "Welt" Schumachers Ablehnung eines Beitritts der Bundesrepublik zur Ruhrbehörde und zum Europarat scharf kritisierte und dem Parteivorsitzenden ein "verhängnisvolles Bestreben" vorwarf, "den Patriotismus für die SPD zu monopolisieren". Schumacher, der nach 1945 zu den Verfechtern einer Politik der europäischen Integration gezählt hatte und alles andere als ein Nationalist war, pochte im Streit um die Westintegration der Bundesrepublik auf deren Gleichberechtigung, weil er Deutschland nicht den "Verlockungen des Nationalismus" aussetzen wollte.
In seiner Einleitung vermag es Willy Albrecht leider nicht, historische Hintergründe zu erhellen, dem dramatischen Geschehen Leben und den Akteuren ein Gesicht zu geben. Er listet zwar akribisch genau die Namen aller Referatsleiter und Mitglieder der Kommissionen und Ausschüsse beim Parteivorstand auf, geht aber nicht auf deren Rang und Bedeutung innerhalb der Partei und den jeweiligen Gremien ein. Viele seiner Ausführungen vermögen nicht zu überzeugen. So begann die vermeintliche "Spitzenkarriere" der beiden Wirtschaftsexperten, Erik Nölting und Fritz Baade, in der Partei gewiß nicht mit ihrer Wahl in den Fraktionsvorstand. Nölting wäre 1949 das Amt des Wirtschaftsministers angetragen worden, wenn die SPD die Bundestagswahl gewonnen hätte. Als er 1953 verstarb, hatte er schon an Einfluß verloren. Der Direktor des Instituts für Weltwirtschaft, Baade, der nicht einmal den Sprung in den Parteivorstand schaffte und schon 1951 wieder aus dem Fraktionsvorstand ausschied, gehörte nie zur ersten Garnitur der Partei. Auch darf man bezweifeln, daß Carlo Schmid und der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Walter Menzel, die "große Sachkompetenz" des SPD-Parteivorsitzenden bei den Bonner Grundgesetzberatungen "nicht ersetzen" konnten. Beide waren im Gegensatz zu Schumacher ausgewiesene und auch vom Parteigegner anerkannte Verfassungsexperten.
PETRA WEBER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
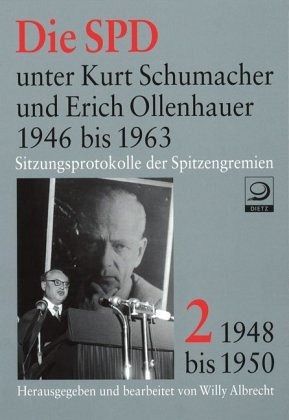




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.12.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.12.2003