"Seelenpfuscher" nennt sie die Therapeuten, die in ihren Selbstdarstellungen versprechen, jedes seelische Problem in kürzester Zeit zum Verschwinden zu bringen.
Für Ratsuchende ist oft schwer zu erkennen, wie seriös ein Angebot ist. Die Seelenpfuscher schmücken sich mit frei erfundenen Titeln und Diplomen, auf ihren Websites wimmelt es von positiven Erfahrungsberichten, manche schaffen es gar in das Angebot der Volkshochschulen oder der beruflichen Weiterbildung.
Hier will Dierbachs Buch aufklären: Die Autorin hat neun der populärsten Pseudotherapien unter die Lupe genommen. Dort wird, so ihr Ergebnis, nicht nur für zum Teil sehr viel Geld sehr viel Unsinn erzählt, die Pseudotherapien machen kranke Menschen sogar noch kränker. Was für einen Gesunden, der ein wenig Selbsterfahrung sucht, angehen mag, kann psychisch angeschlagene oder erkrankte Menschen in tiefe Krisen stürzen, sie sogar in den Selbstmord treiben. Die Zahl derjenigen, die nach einer Pseudotherapie professionelle Hilfe benötigen, steige stetig, zitiert die Autorin die Sekten-Info Nordrhein-Westfalen.
Die Ausbildung der Wunderheiler beschränkt sich meist auf ein paar Wochenendseminare der von ihnen vertretenen Schule, manchmal verfügen sie über einen Heilpraktikerschein, im schlimmsten Fall reicht eine Lebenskrise, gefolgt von einer "Erleuchtung", als Qualifikation. Niemand, so Dierbach, käme auf die Idee, sich von einem Arzt mit einer solchen Qualifikation operieren zu lassen. Mit seiner Seele, so ihr Alarmruf, sollte man nicht weniger vorsichtig sein.
In einer guten Psychotherapie bestimmt der Patient, wie schnell er sich einer seelischen Verletzung nähern will. In einer Pseudotherapie werden dagegen seelische Wunden in Windeseile aufgerissen - und für die Heilung bleibt keine Zeit. Der Kunde erlebt ein Wochenende voller intensiver Empfindungen und fühlt sich in der Tat hinterher anders als zuvor. Das gilt vor allem, wenn es in den Sitzungen zu Konstellationen kommt, die dem Profi die Haare zu Berge stehen lassen: Da werden Einzelne in Gruppensitzungen regelrecht vorgeführt, werden beschimpft und kleingemacht, wo eine Psychotherapie den Menschen doch wachsen lassen sollte.
Während ein guter Psychotherapeut den Patienten dabei unterstützt, seinen eigenen Weg zu finden, und versucht, sich selbst überflüssig zu machen, ist es für Pseudotherapien typisch, dass der Anbieter bestimmt, wo es langgeht. Er weiß den rechten Weg, der Kunde muss ihm folgen wie einem Guru. Der Anbieter nutzt seine Position, um sein Ego und seinen Geldbeutel aufzubessern und bisweilen auch um seine Moralvorstellungen zu propagieren. Und diese sind, so hat Dierbach herausgefunden, eher konservativ bis reaktionär, obwohl die fraglichen Therapien meist von Kunden wahrgenommen werden, die sich politisch eher links verorten. So wird in der Familienaufstellung nach dem Marktführer unter den Pseudotherapien in Deutschland eine "Ordnung" propagiert, in der Frauen abgewertet und Männer, auch bei sexuellem Missbrauch in der Familie, verteidigt werden. Einer Frau wurde auf dem Umweg über das "wissende Feld" mitgeteilt, ihr Brustkrebs sei Sühne für "Unrecht, das einem Mann angetan wurde".
In "The Work" der Amerikanerin Byron Kathleen Reid wird gelehrt, belastende Überzeugungen einfach umzukehren. Angeblich, um sie auf ihren Realitätsgehalt zu überprüfen, faktisch, um dem Ratsuchenden die Schuld an seinem Unglück zuzuschieben, so Dierbach. Mit rhetorischen Tricks wird ein Patient zu der Aussage gedrängt, er wünsche, dass der Krebs weiterwachse. Die als Kind vom Vater vergewaltigte Frau hört sich zu ihrem eigenen Erstaunen behaupten, eigentlich habe sie ihren Vater belästigt.
In dem Bestseller "The Secret" lernen die Kunden, dass sie alles, was ihnen zustößt, selbst verursacht haben. Mit "Bestellungen ans Universum" könnten sie lernen, das Leben nach ihren Wünschen zu verändern. Also am besten das neue Haus beim Universum ordern und gleich neue Möbel dafür anschaffen.
Beschrieben wird, wie Geheimhaltung bei vielen alternativen Angeboten zur "Therapie" gehört. Acht Tage lang sollen sich die bis zu zwanzig Teilnehmer durch ein Programm von zwölf bis vierzehn Stunden am Tag von Kränkungen befreien, die sie in der Kindheit erfahren haben. Dazu lassen sie sich von den vorgeblichen Therapeuten als "Scheinheilige" oder "Zombies" beschimpfen, schreiben Hassbriefe an ihre Eltern, und am Ende kommt der Nikolaus.
Geradezu haarsträubend wird es, wenn ein Geschäftsmodell darauf beruht, dass der Kunde eine bestimmte Anzahl Sitzungen im Voraus zu buchen hat, die dann möglichst an einem abgelegenen Ort stattfinden, den Teilnehmern das Telefonieren verboten wird und sie im Falle von Kritik oder Zweifeln vor der ganzen Gruppe beschimpft werden.
Bei den meisten der von Dierbach vorgestellten Therapien fragt man sich, warum erwachsene Menschen sich so etwas antun. Viele Kunden solcher Pseudotherapien seien krank oder verzweifelt, so Dierbach, manche hätten mit einer seriösen Therapie schlechte Erfahrungen gemacht, andere wollten nicht Wochen auf den nächsten freien Termin bei der Erziehungsberatung warten. Hat man sich psychisch und finanziell erst einmal auf die Pseudotherapie eingelassen, fällt es schwer, Abstand zu nehmen. Und nicht nur das: Sie verhindert, dass der Ratsuchende sich professionelle Hilfe sucht. Denn die Anbieter, so Dierbach, sind meistens nicht in der Lage zu erkennen, wann sie mit einem Patienten konfrontiert sind, der wegen der Schwere seiner Erkrankung in ärztliche Behandlung gehört.
MANUELA LENZEN
Heike Dierbach: "Die Seelen-Pfuscher". Pseudo-Therapien, die krank machen. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2009. 249 S., br., 12,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
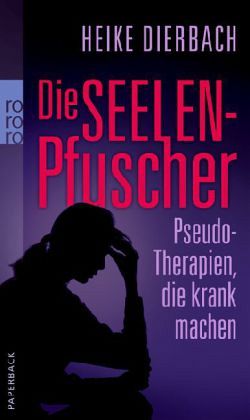





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.01.2010
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.01.2010