sein, wenn ganz Bukarest infiziert wird. Es folgen absurde Stunden bei der Polizei, am Ende stellt sich das Ganze als dreiste Aktion eines dänischen Möchtegernkünstlers heraus.
Bis dahin aber entfaltet Mircea Cartarescus Erzählung "Anthrax", die seinen Band "Die schönen Fremden" eröffnet, auf der Oberfläche ein Panorama, das abwechselnd von hysterischen und fatalistischen Reaktionen des Protagonisten bestimmt ist und, etwas verborgener, ein literarisches Verweissystem aufbaut. Was immer dem Schriftsteller, der den Namen seines Schöpfers trägt, widerfährt, regt ihn beim nachträglichen Berichten zu Vergleichen mit Werken oder Figuren der rumänischen Literaturgeschichte an, zu Hinweisen auf Vorgänger und Weggefährten also, die vom Übersetzer Ernest Wichner aufgeschlüsselt werden. Vor allem aber eröffnet das Buch, indem es den Lebensumständen des rumänischen Autors die des dänischen Aktionskünstlers gegenüberstellt, geschildert aus der erkennbar defizitären Perspektive des nervösen Erzählers, die Diskussion um ganz andere Fragen: die nach Artistik und Ethik beispielsweise oder nach der Verantwortung gegenüber Unbekannten, im Leben wie in der Kunst.
"Die schönen Fremden" ist als Triptychon aufgebaut, mit "Anthrax" und "Wie von Bacovia" als zwei kürzeren Flügeln von je um die fünfzig Seiten und einem viermal so langen Zentrum, das denselben Titel trägt wie der gesamte Band, versehen allerdings mit dem Untertitel "Wie ich ein Dutzendautor war". Er spielt nicht nur auf eine Reise von zwölf rumänischen Schriftstellern nach Frankfurt an, die den wesentlichen Teil der Erzählung ausmacht, sondern auch auf den ewigen Vergleich des Protagonisten mit anderen Autoren seines Landes, der alle drei Texte dieses Bandes in unterschiedlicher Weise prägt. "Die meisten meiner Bücher habe ich im Ausland geschrieben, in Amsterdam, Wien oder in Berlin", hat Cartarescu 2009 im Gespräch mit dieser Zeitung gesagt, "wo ich die innere Ruhe, die Zeit und dank verschiedener Stipendien auch die finanziellen Mittel hatte, die ich zum Schreiben brauche." Dass er außer der offensichtlichen Dankbarkeit auch einen Blick dafür hat, welchen Irrsinn ein Autor dafür gelegentlich mitmachen muss, zeigt besonders der Mittelteil des Buches - aber er zeigt auch, welchen Anteil die Autoren selbst daran haben, wenn seltsame Lesungen und Begegnungen vollends ins Verworrene gleiten.
Am schönsten ist Cartarescu das in der letzten Erzählung gelungen, die in den achtziger Jahren und zu Beginn seiner Existenz als Schriftsteller spielt. Der Protagonist ist zu einer Lesung in die rumänische Provinz eingeladen, und während er sich zu Beginn der Reise noch an den Gedanken hält, "es würde ein Triumphzug werden, alles wies darauf hin", so wird in der Folge jeder einzelne Umstand immer schäbiger - der Transport, das Essen, die Wege, das Publikum. Die gesamte Erzählung über gibt es dieses Wechselspiel von Erwartung und Enttäuschung, wobei die Ausschläge des Pendels immer geringer werden: Die Erwartungen schrumpfen, die Enttäuschungen sind entsprechend geringer, bis das Ganze völlig unerwartet einen förmlichen, literaturgeschichtlich abgesicherten Zauber erhält, wie um den jungen Mann davon abzuhalten, aus allerbesten Gründen das Literatentum sausenzulassen. Manchmal ist dazu eben ein Wunder nötig.
TILMAN SPRECKELSEN
Mircea Cartarescu:
"Die schönen Fremden".
Erzählungen.
Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner. Zsolnay Verlag, Wien 2016. 304 S., geb., 21,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
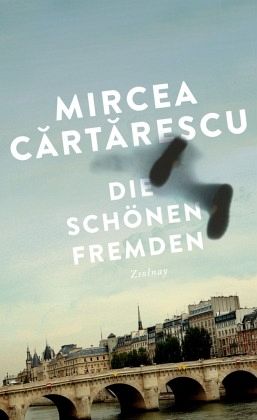



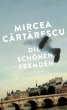

 buecher-magazin.deEin schöner Brauch: Zwölf "Belles Étrangères" der dichtenden Zunft sollen alljährlich Frankreich erobern. 2004 war Rumänien an der Reihe. Mit von der Partie: Mircea Crtrescu, dessen beflügeltes, geistreiches Tournee-Protokoll die Titelgeschichte seines Erzählbandes "Die schönen Fremden" bildet. Hatte der vielfach prämierte Autor seine Leser bisher in einen halluzinatorischen Malstrom gerissen ("Nostalgia", "Travestie", die "Orbitor"-Trilogie), um den gesellschaftlichen Umbruch seiner Heimat aus der schmerzlichen Realität in metaphysische Dimensionen zu erretten, so steuert er nun durch die raue See des Literaturbetriebs: rasant, skurril, (selbst-)ironisch und unendlich belesen. En passant komprimiert er biografische und literarische Splitter seiner Reisegesellen zu bündigen Porträts, und greift dabei gern nach bewährten Bausteinen seines Setzkastens: etwa Film- oder Traumsequenzen, das lustvolle Spiel mit klischeehafter Eigen- und Fremdwahrnehmung, die Überspitzung ins Groteske und die Transzendierung. Ein vermeintlich anthraxhaltiger Brief an Crtrescu führt in einen Taumel durch eine Polizeibehörde "in Umorganisation", begleitet von medial angeheizten Phobien. So wird die Lesereise eines Jungautors durch Rumäniens Provinz zum psychedelischen Roadmovie.
buecher-magazin.deEin schöner Brauch: Zwölf "Belles Étrangères" der dichtenden Zunft sollen alljährlich Frankreich erobern. 2004 war Rumänien an der Reihe. Mit von der Partie: Mircea Crtrescu, dessen beflügeltes, geistreiches Tournee-Protokoll die Titelgeschichte seines Erzählbandes "Die schönen Fremden" bildet. Hatte der vielfach prämierte Autor seine Leser bisher in einen halluzinatorischen Malstrom gerissen ("Nostalgia", "Travestie", die "Orbitor"-Trilogie), um den gesellschaftlichen Umbruch seiner Heimat aus der schmerzlichen Realität in metaphysische Dimensionen zu erretten, so steuert er nun durch die raue See des Literaturbetriebs: rasant, skurril, (selbst-)ironisch und unendlich belesen. En passant komprimiert er biografische und literarische Splitter seiner Reisegesellen zu bündigen Porträts, und greift dabei gern nach bewährten Bausteinen seines Setzkastens: etwa Film- oder Traumsequenzen, das lustvolle Spiel mit klischeehafter Eigen- und Fremdwahrnehmung, die Überspitzung ins Groteske und die Transzendierung. Ein vermeintlich anthraxhaltiger Brief an Crtrescu führt in einen Taumel durch eine Polizeibehörde "in Umorganisation", begleitet von medial angeheizten Phobien. So wird die Lesereise eines Jungautors durch Rumäniens Provinz zum psychedelischen Roadmovie. Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.06.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.06.2016