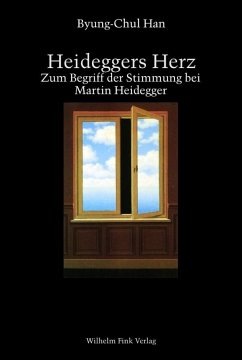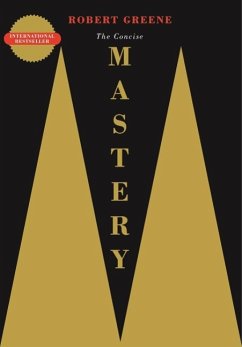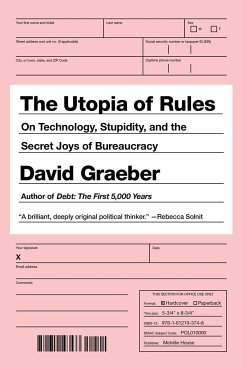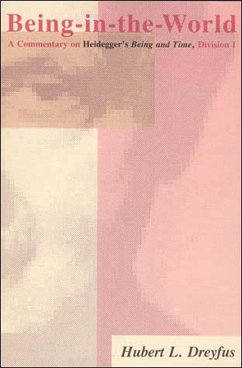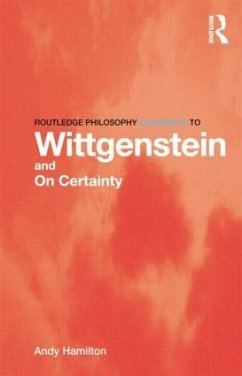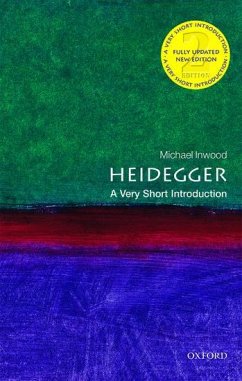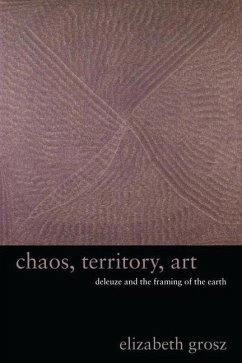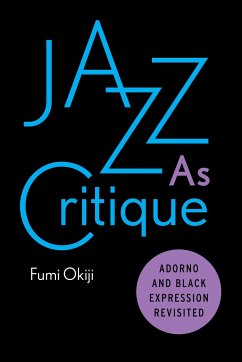Die Regeln der Intuition
Kunstphilosophie nach Adorno, Heidegger und Wittgenstein
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
72,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Mit dem Blick auf den Intuitionsbegriff, der von Bergson und Croce herrührt und für die Ästhetik dieses Jahrhunderts unter dem Topos "Kunst als Sprache" prägend geworden ist, können Adorno, Heidegger und Wittgenstein verglichen werden. Die Besonderheit der Kunst wird einerseits unter dem Aspekt der Bedingungen diskutiert, die das Lesen ermöglichen. Andererseits versucht die Frage, wie sich der Sinn grundlegender logischer Kategorien (Negation, Implikation, Vollständigkeit) etabliert und verändert, die Rolle der Kunst als Grundlage nicht nur der Wahrnehmung, sondern auch der Logik nachz...
Mit dem Blick auf den Intuitionsbegriff, der von Bergson und Croce herrührt und für die Ästhetik dieses Jahrhunderts unter dem Topos "Kunst als Sprache" prägend geworden ist, können Adorno, Heidegger und Wittgenstein verglichen werden. Die Besonderheit der Kunst wird einerseits unter dem Aspekt der Bedingungen diskutiert, die das Lesen ermöglichen. Andererseits versucht die Frage, wie sich der Sinn grundlegender logischer Kategorien (Negation, Implikation, Vollständigkeit) etabliert und verändert, die Rolle der Kunst als Grundlage nicht nur der Wahrnehmung, sondern auch der Logik nachzuzeichnen.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.