innenpolitischen Konflikte im Zeitalter der "Römischen Revolution" verstrickt werden.
Cicero identifizierte sich zunächst mit den Traditionen und Strukturen der römischen Republik, glaubte an die Illusion einer concordia ordinum, einer gemeinsamen Politik der Stände der römischen Oberschichten. Dabei verkannte er völlig die faktisch dominierende Macht der römischen Heeresgefolgschaften wie die Tiefe und Dynamik der sozialen und strukturellen Konflikte. Seine Vermittlungsversuche zwischen dem Senat und den Triumvirn (Caesar, Pompeius, Crassus) scheiterten, sein verdeckter Kampf gegen Caesars Diktatur trug zwar zu dessen Ermordung bei, doch der folgende Bürgerkrieg besiegelte Ciceros politische Katastrophe und brachte ihm den Tod.
Dieses ganze Leben war von Reden begleitet, von denen noch 58 erhalten sind. Seinen Reden in zivilen wie in Strafprozessen, nicht zuletzt den mutigen und erfolgreichen Reden gegen Verres, den korrupten Statthalter in Sizilien, verdankte Cicero seinen Aufstieg. Das Wirken in der Öffentlichkeit, vor den Gerichtshöfen wie im Senat, fand dann in den großen politischen Reden - den Reden gegen Catilina, Clodius und Antonius vor allem - eine einzigartige Resonanz. Denn Cicero war befähigt, jede Sache zu verteidigen und jeder Konstellation gerecht zu werden; die Kunst der Rhetorik war bei ihm identisch mit der Kunst der Manipulation.
Eben darin liegt das spezifische Interesse der Gegenwart an den literarischen Fassungen dieser einst frei vorgetragenen Reden: Nicht mehr primär die kunstvollen Kompositionen, die wechselnden stilistischen Formen der "schlichten, mittleren und leidenschaftlich-pathetischen" Ebenen, nicht mehr die Prägnanz im Ausdruck oder der souveräne Einsatz aller rhetorischen Finessen vermögen heute noch, wie in früheren Jahrhunderten, die Leser zu faszinieren. Von wirklich aktueller Bedeutung bleiben hingegen - wie Manfred Fuhrmann schon früh gesehen hat - die Techniken und Modalitäten der erfolgreichen Beeinflussung von Gerichtshöfen, politischen Gremien und großen Versammlungen, die effiziente Insinuation und Manipulation der Meinungen und der Beurteilungen. Um sie adäquat analysieren zu können, sind freilich präzise Kenntnisse der jeweiligen juristischen und politischen Voraussetzungen und Zusammenhänge erforderlich - und ebendiese vermitteln Fuhrmanns Cicero-Editionen in vorbildlicher Weise, ohne sich je in juristischen und stilistischen Quisquilien oder im Auftürmen von bibliographischen Titeln zu verlieren.
Manfred Fuhrmanns kommentierte Übersetzung sämtlicher Reden Ciceros in sieben Bänden mit insgesamt über dreitausend Seiten begann vor über einem Vierteljahrhundert im Züricher Artemis Verlag zu erscheinen (1970 bis 1982). Zu Beginn der neunziger Jahre folgte dann eine parallele lateinisch-deutsche Edition zunächst der Politischen Reden im engeren Sinne (Drei Bände, München 1993) und der Reden gegen Verres (Zwei Bände, Zürich 1995), die nun durch die entsprechende Ausgabe der Prozeßreden in wiederum zwei Bänden abgeschlossen wird. Zwischendurch hatte der frühere Konstanzer Latinist den Autor, dem er sich jahrzehntelang widmete, in der glänzenden Monographie "Cicero und die römische Republik" (Zürich 1989) auch einem größeren Leserkreis vergegenwärtigt.
Der lateinische Text der vorliegenden Edition entspricht bis auf wenige Stellen demjenigen der bekannten Oxford-Ausgabe von Clark und Peterson; Übersetzung, Einleitungen und Erläuterungen sind den Bänden entnommen, die bereits früher bei Artemis erschienen waren und wurden um die bibliographischen Angaben ergänzt. Über die Qualität der Übersetzungen ist kein Wort mehr zu verlieren; sie sind längst zum Vorbild für zeitgemäße Übertragungen lateinischer Texte in die deutsche Sprache geworden. KARL CHRIST
Marcus Tullius Cicero: "Die Prozeßreden". Zwei Bände. Lateinisch-deutsch. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Manfred Fuhrmann. Artemis & Winkler Verlag, Zürich/Düsseldorf 1997. 912 und 893 S., geb., zus. 178,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
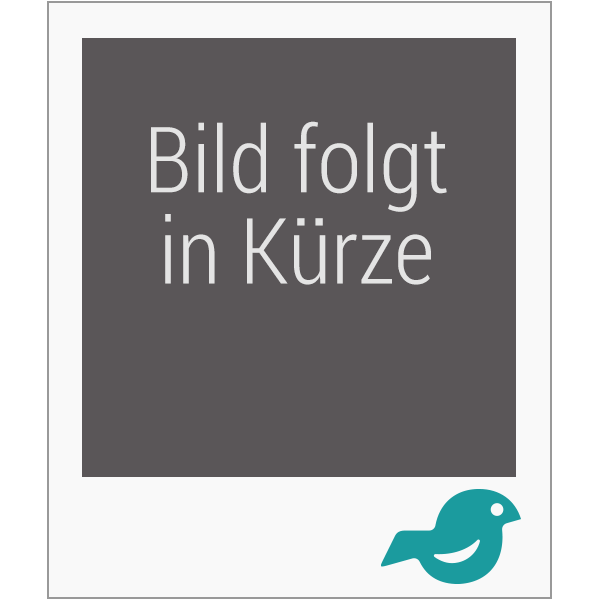



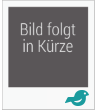

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.10.1997
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.10.1997