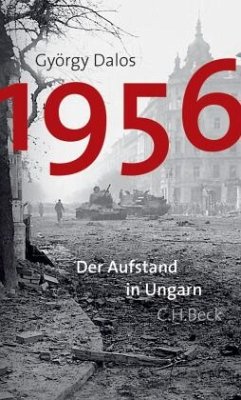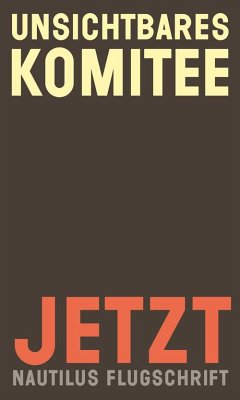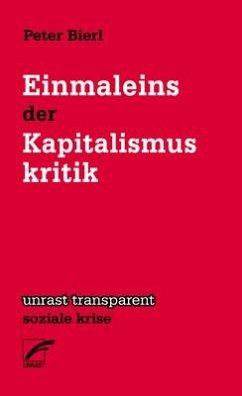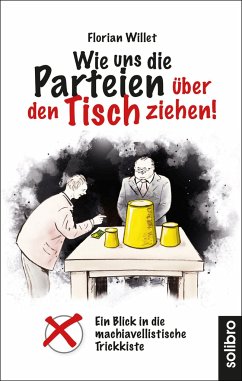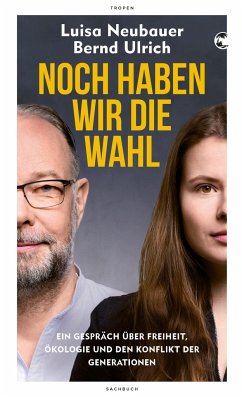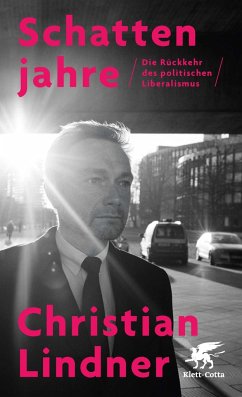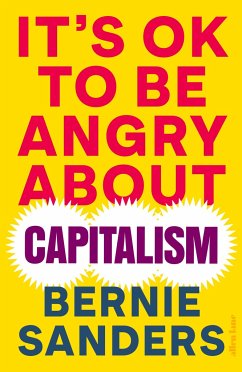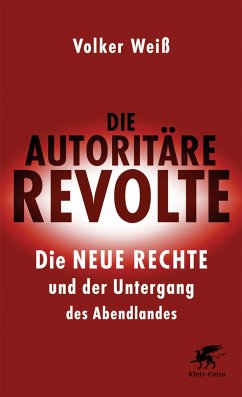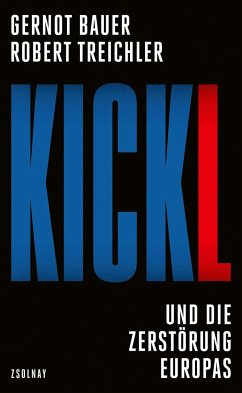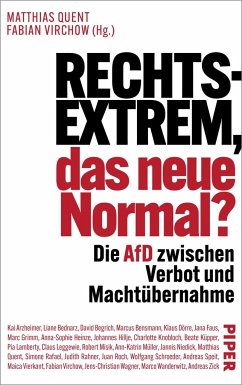verdrängt habe.
Darauf bezieht sich der französische Titel "Die Kinder der Leere. Von der individualistischen Sackgasse zum bürger(schaft)lichen Erwachen". Beide Theoriestränge, der liberale als Garant individueller Freiheit wie der demokratische als Instrument kollektiver Selbstbestimmung, müssten zu ihrem Recht kommen. Denn "die Dynamik der freiheitlichen Demokratien entsteht aus dieser explosiven Begegnung des demokratischen und des liberalen Denkens . . . Wenn einer dieser Pole zu stark wird und nicht mehr ausgeglichen werden kann, ist entweder die Demokratie nicht mehr liberal oder der Liberalismus nicht mehr demokratisch - es kommt zur Krise."
Glucksmanns Analyse des Neoliberalismus (das ist für ihn der Irrweg, den etwa Hayek und Milton Friedman eingeschlagen haben) ist eine gut formulierte Zusammenfassung von vielem, was dazu in den letzten Jahren Kritisches geschrieben worden ist. Sein Gegenmodell ist keineswegs sozialistisch, auch wenn er die maßlosen Gehälter von Managern verurteilt und Freihandelsabkommen misstraut, weil sie seiner Meinung nach die Tendenz haben, in der Europäischen Union schon erreichte ökologische Standards zu untergraben. Schließlich kennt er die verheerende Bilanz des real existierenden Sozialismus, die sein Vater in einer Analyse des totalitären Charakters marxistischer Ideologie vorlegte.
Die Autoren, die Glucksmann inspirieren, sind vor allem Machiavelli (natürlich nicht der Fürstenberater des "Principe", sondern der patriotische Republikaner der "Discorsi") und antike Philosophen; Hannah Arendt wird zweimal erwähnt, aber ihre Theorie politischer Macht, die aus dem Zusammenhandeln der Bürger entstehe, prägt seine Argumente von Anfang bis Ende. Wo Machiavelli (und nach ihm Rousseau) eine Zivilreligion als Begründung und Stütze des bürgerschaftlichen Engagements fordert, findet Glucksmann, ganz Kind der französischen Laizität, in der "politischen Ökologie" die nicht mehr hintergehbare Grundlage des gemeinschaftlichen Überlebens und Zusammenlebens. Das soll der neue Kompass sein, der dem bürgerschaftlichen Handeln die Richtung vorgibt.
Für die angestrebte Synthese aus liberalem Individualismus und demokratischer Selbstbestimmung brauche es eine Ergänzung der repräsentativen Regierungsformen mit Elementen "partizipativer Demokratie"; also keinen Neubau, sondern eine Art Anbau an die bestehenden Systeme. Auch da betritt der Autor kein Neuland, er kann sich aus dem Fundus der amerikanischen Kommunitaristen bedienen; in Frankreich hat der Historiker Pierre Rosanvallon die Entwicklung der repräsentativen Demokratie beschrieben und ihre Anreicherung mit Elementen und Institutionen partizipativer Demokratie empfohlen.
In summa: mehr Beteiligung der Bürger an Planungs- und Entscheidungsprozessen. Das ist nicht mit schlichten Vorstellungen von direkter Demokratie ("mehr Volksabstimmungen") zu verwechseln, die für moderne Gesellschaften untauglich sind, noch weniger hat es mit dem souveränistischen Denken zu tun, das in Frankreich rechts wie links kursiert. Glucksmann schlägt zudem die Einführung eines Grundeinkommens für alle vor, aber auch einen obligatorischen Zivildienst, der vermitteln soll, dass Bürger nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten haben, und der den Gemeinsinn fördern könnte. Solche Vorschläge kursieren auch hierzulande, und vielleicht gibt es im Werkzeugkasten der partizipativen Demokratie tatsächlich Instrumente, die sich zum Einbau in die westlichen Repräsentativsysteme eignen - um diese zu stärken und den Populisten Wind aus den Segeln zu nehmen.
Glucksmann selbst hat sich in die politische Arena begeben. Obwohl er gar nicht Mitglied der Partei ist, haben ihn die Sozialisten als ihren Spitzenkandidaten für die bevorstehende Europawahl nominiert. Allerdings ist das ein Symptom von Verzweiflung: Bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen lagen die Ergebnisse der bis Mitte 2017 regierenden Sozialistischen Partei deutlich unter zehn Prozent. Wenn die von Glucksmann angeführte Liste besser abschnitte, wäre das ein Erfolg. Ob die in Marxisten, Sozialdemokraten und Sozialliberale gespaltene Partei deshalb seine Ideen ernst nähme, ist eine andere Frage.
GÜNTHER NONNENMACHER
Raphaël Glucksmann:
"Die Politik sind wir!" Gegen den Egoismus,
für einen neuen Gesellschaftsvertrag.
Aus dem Französischen von Stephanie Singh. Carl Hanser Verlag, München 2019. 191 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
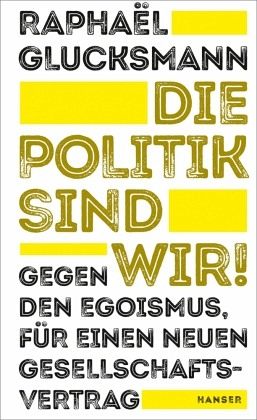










 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.05.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.05.2019