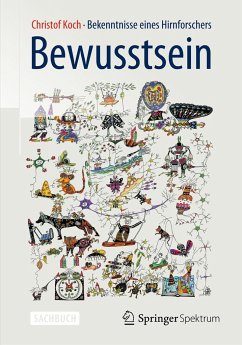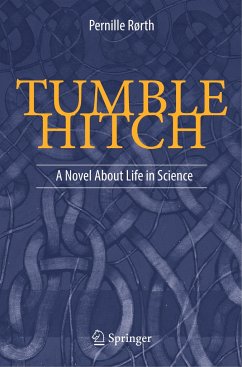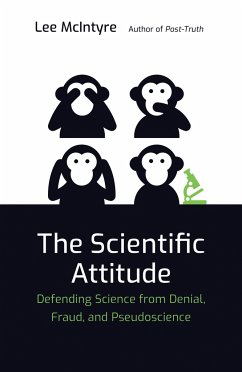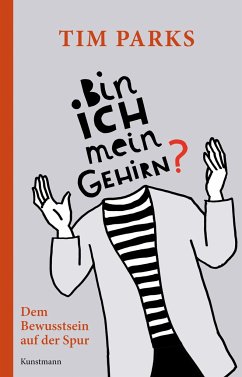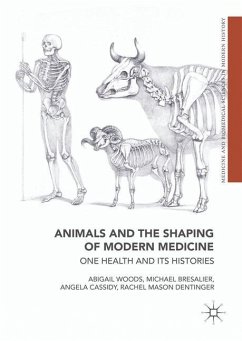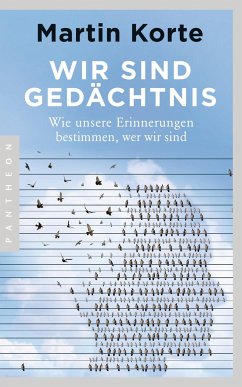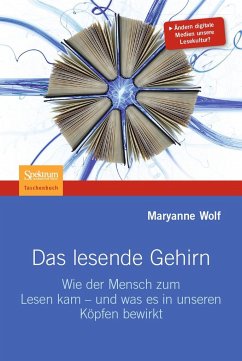Orientierung an der Zukunft behielt Kaku bei, als er von physikalischen Theorien überging zu weiter gefassten Szenarien: zu Prognosen darüber, welche technologischen Innovationen die Zukunft auf den unterschiedlichsten Feldern bringen wird.
Science-Fiction-Filme spielen für Kaku dabei eine wichtige Rolle. In seinem Buch "Physik des Unmöglichen" verstand sich das noch von selbst: Es hatte die Frage zum Leitfaden, welche Science-Fiction-Wundertechniken - von Teleportation über Abwehrkraftfelder bis zu Lichtschwertern - physikalisch überhaupt möglich sind, und wenn ja, mit welchen technologischen Schritten sie zu erreichen wären. In der im letzten Jahr auf Deutsch erschienenen "Physik der Zukunft" ging es dann um Prognosen, welche Technologien in den nächsten zwanzig, fünfzig und hundert Jahren entwickelt werden: Extrapolation aus den jetzt bereits sichtbaren Tendenzen in den Forschungslabors und Entwicklungsabteilungen, in denen sich Kaku auf der ganzen Welt umgesehen hatte.
Science-Fiction blieb dabei aber unübersehbar präsent: Wenn Kaku sein Leitmotiv anschlug, dass uns die neuen Technologien zu Beherrschern einer restlos kulturell durchdrungenen Welt machen werden (weil dann an so gut wie jedem Ort zu jeder Zeit Daten berechnet werden), in der wir die Dinge allein durch unsere Gedanken steuern können, waren Beispiele aus der Science-Fiction parat. Und in Kakus jüngstem, nun fast gleichzeitig mit der amerikanischen Ausgabe erschienenen Buch stößt man fortlaufend auf sie. Es fokussiert auf ein Segment der wissenschaftlich-technologischen Zukunftslandschaft: Technologien, die an das Gehirn ankoppeln. Es sind die neurowissenschaftlichen Labors, in denen Kaku sich nun umhört, um herauszufinden, wohin der Weg führen könnte, den absehbare Fortschritte in unserem Verständnis und unserer Beherrschung der Gehirnfunktionen eröffnen.
Und es sind nach wie vor beherzte Vorgriffe auf das Gelingen von Forschungsansätzen und technischen Settings, die dabei den Ton angeben. Sogar noch deutlicher als in der "Physik der Zukunft", die das Gebiet der Hirnforschung bereits gestreift hatte. Denn der Ausblick auf die wissenschaftlich-technologische Durchdringung des Gehirns, damit also des Geistes, bringt zentrale Register von Kakus futurologisch eingestimmter und mit Science-Fiction-Szenarien unterfütterter Imagination ins Schwingen.
Man merkt es gleich daran, dass es losgeht mit der direkten Übertragung von neuronalen Aktivitätsmustern zwischen verschiedenen Gehirnen und den Möglichkeiten, Gegenstände direkt durch Gedanken zu steuern. Die Macht der Gedanken, ohne Dazwischentreten der Körper, darin steckt für Kaku die Verheißung eines alten Menschheittraums. In wenigen Schritten werden daraus bei ihm Szenarien eines Internets des Geistes, das durch direkte Hirn-Hirn-Kontakte geknüpft ist. Noch einen Schritt weiter, und man steht vor Beschwörungen der gänzlichen Verschmelzung von mentalen wie sensorischen Inhalten verschiedener Individuen. Ebenso schnell geht es von den noch bescheidenen Versuchen, bestimmte neuronale Outputs zwischen (Mäuse-)Gehirnen zu transferieren, hin zu Szenarien, in denen bestimmte Erinnerungen, Kompetenzen oder gleich gesamte Erinnerungsarchive in Gehirne "hochgeladen" werden.
Noch ein Schritt weiter, und man hält bei einer "Bibliothek der Seelen", mit der es möglich wird, in Lebensläufe zu schlüpfen, die durch die vollständige Aufzeichnung und Abspeicherung von mentalen Daten verfügbar geworden sind. Und natürlich steht am Fluchtpunkt solcher Wege auch die Frage, wie es mit dem endgültigen Abkoppeln des Geistes vom gebrechlichen Körper einmal aussehen mag. Oder dessen eben, was dann auf Silizium abgespeichert oder auf einem Lichtstrahl in die Weiten des Raums befördert wird - um dort irgendetwas zu tun, was wir uns absolut nicht ausmalen können.
Damit sind freilich nur einige Stationen auf dem weitläufigen Parcours von Michio Kaku bezeichnet. Sie zeigen den Sog der Science-Fiction, und naturgemäß neigt Kaku dazu, die Schwierigkeiten der ausgemalten Technologien in den Hintergrund zu rücken. Er führt sie zwar an, hält sich aber bei ihnen nicht weiter auf, sondern zieht die Linien aus in eine Zukunft, die bei ihm die Summe des technologisch Machbaren ist. Kaku ist ein Emphatiker dieser Zukunft. Ein paar Hinweise auf ihre Risiken mag er zwar einstreuen. Aber dass tiefe Wünsche in ihr in Erfüllung gehen, darum dreht sich bei ihm alles.
Was ein wenig auch deshalb verwundert, weil die filmischen Science-Fiction-Plots, die er anführt, eigentlich eine andere Sprache sprechen. In ihnen geht es in der Regel eher darum, dass die perfektionierten Neurotechnologien fatale Effekte und Überlastungen hervorbringen - und so im Konstrastverfahren vorführen, was es mit einem menschlichen Leben herkömmlicher Bauart auf sich hat. Bei Kaku leiten sie dagegen über zu den schlichtweg aufregenden Möglichkeiten der Zukunft. Über die gesellschaftlichen Bedingungen und Folgen der ins Auge gefassten Technologien zerbricht er sich nicht den Kopf.
Man kann bei Kaku durchaus etwas über einige Ansätze auf dem Feld der Neurowissenschaften lernen. Aber im Ganzen doch eher über Erwartungen, Hoffnungen oder auch Versprechungen, die hinter ihnen stehen - und zwar vor allem solche gewagter und steiler Art. Sie sind eben der Stoff, den ein emphatischer Futurologe der Technik wie Kaku mit Vorliebe bearbeitet.
HELMUT MAYER
Michio Kaku: "Die Physik des Bewusstseins". Über die Zukunft des Geistes. Aus dem Englischen von Monika Niehaus. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2014. 542 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
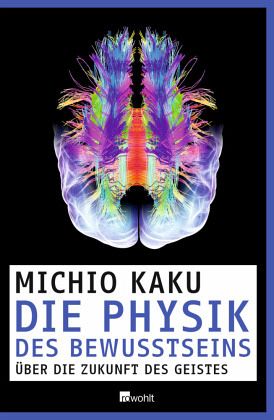





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.03.2014
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.03.2014