Nicht lieferbar
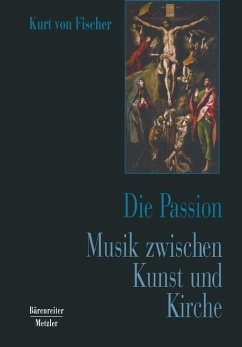
Die Passion, Musik zwischen Kunst und Kirche
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
The Passion between Art and Church. 143 p. w. 29 partly col. ill. and 64 music examples.(Text in German)Based on great masterworks and important paintings, the author examines the development of the musical genre "Passion" from the Middle Ages to the present. He explains the different ideas characteristic of epochs, styles and composers.Kurt von Fischer zeichnet die Geschichte der Passion im Spannungsfeld zwischen künstlerischen Ambitionen und kirchlich-liturgischen Vorgaben vom Mittelalter bis zur Gegenwart anhand der großen Meisterwerke der Musik und Malerei nach. Er versteht es, sowohl de...
The Passion between Art and Church. 143 p. w. 29 partly col. ill. and 64 music examples.
(Text in German)
Based on great masterworks and important paintings, the author examines the development of the musical genre "Passion" from the Middle Ages to the present. He explains the different ideas characteristic of epochs, styles and composers.Kurt von Fischer zeichnet die Geschichte der Passion im Spannungsfeld zwischen künstlerischen Ambitionen und kirchlich-liturgischen Vorgaben vom Mittelalter bis zur Gegenwart anhand der großen Meisterwerke der Musik und Malerei nach. Er versteht es, sowohl dem Musikinteressierten kompositionsgeschichtliche Entwicklungen zu verdeutlichen, als auch dem theologischen Laien religionsgeschichtliches Grundwissen zu vermitteln und so zu einem lebendigen Umgang mit den Vertonungen des neutestamentlichen Berichtes von der Passion Christi anzuregen.
(Text in German)
Based on great masterworks and important paintings, the author examines the development of the musical genre "Passion" from the Middle Ages to the present. He explains the different ideas characteristic of epochs, styles and composers.Kurt von Fischer zeichnet die Geschichte der Passion im Spannungsfeld zwischen künstlerischen Ambitionen und kirchlich-liturgischen Vorgaben vom Mittelalter bis zur Gegenwart anhand der großen Meisterwerke der Musik und Malerei nach. Er versteht es, sowohl dem Musikinteressierten kompositionsgeschichtliche Entwicklungen zu verdeutlichen, als auch dem theologischen Laien religionsgeschichtliches Grundwissen zu vermitteln und so zu einem lebendigen Umgang mit den Vertonungen des neutestamentlichen Berichtes von der Passion Christi anzuregen.



