halbtote Opfer, und die Krankenhäuser sind der Wirt. Bis in die neunziger Jahre erhielten die Krankenhäuser denn auch wie der Wirt eine Kostenpauschale, die sich an den Liegezeiten der Patienten orientierte.
Der zweite Grundfall ist der Truppenverbandsplatz mit tausend Verwundeten, zehn Sanitätern und zwei Ärzten. Wer sich das nicht vorstellen kann, sollte in "Vom Winde verweht" nachlesen, wie Scarlett O'Hara kurz vor dem Fall Atlantas Dr. Meade von einer Sammelstelle für Verwundete holen wollte. Er ist dann klüger als viele Soziologen und die meisten Politiker, die immer wieder versprechen, jeder Kranke erhalte auf ewig die bestmögliche medizinische Versorgung.
Dabei haben die Gesundheitspolitiker selbst dafür gesorgt, daß sich der Wirt im Samariter-Fall künftig genau überlegt, für wie viele Opfer mit welchen Wunden er künftig sorgen will. Die Politiker haben die Liegezeit durch typische Fälle ersetzt. Seit 2003 erhalten die Krankenhäuser für jede Blinddarm- oder Gallenoperation oder für jede Krebsbehandlung einen vorher errechneten und festgelegten Pauschbetrag. Versorgen die Häuser viele Patienten mit anerkannt teuren Behandlungen, erhalten sie viel Geld und umgekehrt. Wie auch der Laie versteht, mußte das zu einem starken Abbau der Krankenhausbetten führen. Er soll um die fünfunddreißig Prozent betragen. Darüber freuen sich die Gesundheitsminister. Ob sich auch die Patienten darüber freuen, ist nicht so klar, weil für sie weniger Zeit zur Verfügung steht.
Die beiden Bücher über Krankenhäuser sind ausgezeichnet, sie reagieren auf die Änderung der Finanzierung. "Krankenhaus und soziale Gerechtigkeit" ist ein Sammelband mit acht Beiträgen fachkundiger Autoren. Sie erörtern das Grundproblem unter den Aspekten der Gerechtigkeitsphilosophie, der Organisation, der ökonomischen Ziele, der Rationierung, der Ärzte, der Patienten und der Sicherstellung medizinischer Leistungen. Tendenz kritisch, aber im wesentlichen plausibel. Das Buch von Werner Vogd bietet gleichsam eine wissenschaftliche Vertiefung. Es versucht, die "Gesundheitsreform" objektiv auch unter dem Aspekt ihrer eigenen Zielsetzung zu bewerten.
In dem Band "Krankenhaus und soziale Gerechtigkeit" kommt freilich "soziale Gerechtigkeit" praktisch nicht vor. Das ist nicht erstaunlich, weil niemand sie formulieren, das heißt abgrenzen kann. Selbst Hans-Jürgen Firnkorn, offenbar ein Krankenhausmanager, der den Aufsatz zum Generalthema geschrieben hat, kommt nach einigen waghalsigen Versuchen zu dem Ergebnis, soziale Gerechtigkeit lasse sich als solche nicht operationalisieren und werde immer dann erheblich, wenn die klassischen Gerechtigkeitsbegriffe in Aporien führten. Wen das nicht zufriedenstellt, der kann sich dann damit trösten, daß Firnkorn einen sehr klaren und informativen Überblick über eine Krankenhausverwaltung gibt, bis zu den Einkünften der Ärzte und Pflegekräfte (aber nicht des Managements).
Daß die Autoren "soziale Gerechtigkeit" schreiben, wenn sie Kosten und Nutzen, Zuordnung und Gleichheit, Macht und Abhängigkeit meinen, ist nicht nur ein Schönheitsfehler. Es verstellt den Blick für Funktionen. Die Post ernährt zwar ihre Bediensteten, ihre Daseinsberechtigung gewinnt sie aber aus der Beförderung von Nachrichten und Gütern. Auch Krankenhäuser gibt es nur, weil in ihnen Krankheiten geheilt werden können. Dafür ist das Personal unterschiedlich wichtig. Diese Beziehungen klärt man nicht, wenn man Patienten, Ärzte, Pfleger und sonstiges Personal einfach sozial gerecht betrachtet.
Die Liebe der Krankenhausfachleute zur sozialen Gerechtigkeit dürfte darauf beruhen, daß es keine Theorie des Gesundheitswesens gibt und geben kann. Die Medizin verdient ihr Geld nicht mit Gesundheit, sondern mit Krankheit. Für sie ist also positiv besetzt, was für das Publikum ein Unwert ist. Das führt notwendig in Paradoxien, die durch sachgerechte Unterscheidungen aufzulösen wären, aber mit Ethik und Sozialem zugedeckt werden. "Ökonomische Ziele versus ethische Pflichten" zum Beispiel blendet aus, daß Heilen etwas kostet und daß der Wurm nicht in der Richtigkeit von Anreizen, sondern in den Anreizen selbst steckt. Der Samariter hat kein Geld genommen, sondern er hat etwas gegeben. Hilfe in Not läßt sich nicht bezahlen.
Abgesehen von der Liebe zur Ethik, ist der Sammelband eingängiger und leichter zu lesen als die Arbeit von Vogd. Dafür ist Vogd weit tiefer und gründlicher. Zwar berührt das strukturelle Theoriedefizit der Medizin auch seine Argumentation. Aber er überkompensiert es durch seine konsequente Orientierung an der Praxis. Vogd hat nicht einfach statistisches Material verarbeitet, sondern er hat von 2000 bis 2002 die Arbeit in den chirurgischen und internistischen Abteilungen zweier städtischer Kliniken beobachtend begleitet. Er hat zugeschaut, mit Ärzten und Schwestern gesprochen und dann seine Beobachtungen aufgezeichnet. Nach 2002 wurden die Kliniken privaten Trägergesellschaften übergeben (privatisiert). Im Jahr 2003 trat die Umstellung der Krankenhausfinanzierung allgemein in Kraft. Deshalb hat Vogd dieselben Abteilungen in denselben Häusern nach denselben Prinzipien in den Jahren 2004 und 2005 noch einmal beobachtet, seine Beobachtungen wieder aufgezeichnet und beide Untersuchungen verglichen. Eine geglückte wissenschaftliche Leistung mit feinen Differenzierungen.
Das Ergebnis stellt der deutschen Gesundheitspolitik kein gutes Zeugnis aus. Die Krankenhäuser arbeiten zwar billiger als vor der Reform, aber zu Lasten der Ärzte und Patienten. Die Ärzte stehen unter Dauerstress, die Facharztausbildung ist praktisch gestrichen, das grundlegende Einverständnis von Ärzten und Verwaltung gestört. Wegen des hohen Personalkostenanteils im Gesundheitswesen muß in der Tat das Personal Einsparungen bezahlen. Offen ist nur, ob die Schwierigkeiten im Laufe der Zeit in Routine versickern oder die Leistungsfähigkeit der Häuser auf Dauer mindern. Die Ärztestreiks versteht man jedenfalls besser, wenn man das Buch gelesen hat.
Vogds Untersuchungen liefern auch empirisches Material für die Auswirkungen elektronischer Kommunikation. Die Krankenhäuser haben natürlich den Ärzten und dem Pflegepersonal Handys und PCs zur Verfügung gestellt. Deshalb ist heute praktisch jeder Arzt jederzeit von jedermann erreichbar, wenn er nicht gerade mit einem anderen spricht. Die Folgen: Die Hierarchien geraten durcheinander, und die Ärzte werden überbeansprucht, weil die Schonräume wegfallen, die die schlechtere Erreichbarkeit aufgerichtet hatte.
Das Buch ist ein Glücksfall, auch wenn der Inhalt nicht gerade heiter stimmt.
GERD ROELLECKE
Manfred Georg Krukemeyer/Georg Murckmann/Urban Wiesing (Hrsg.): "Krankenhaus und soziale Gerechtigkeit". Schattauer, Stuttgart 2005. XII, 185 S., geb. 34,95 [Euro].
Werner Vogd: "Die Organisation Krankenhaus im Wandel". Eine dokumentarische Evaluation aus Sicht der ärztlichen Akteure. Verlag Hans Huber, Bern 2006. 293 S., br., 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
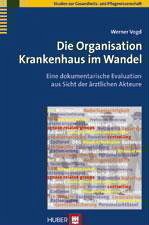




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.09.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.09.2006