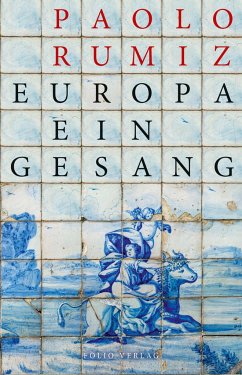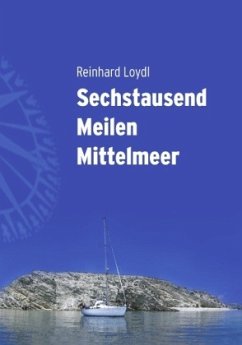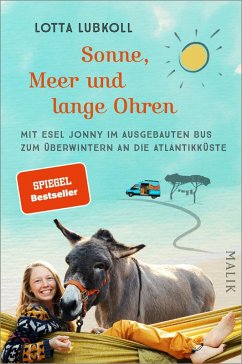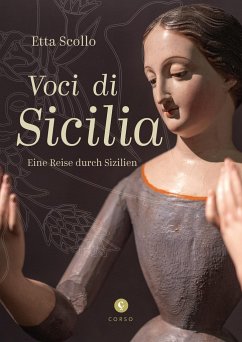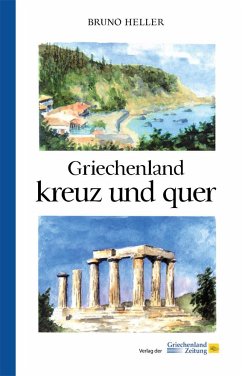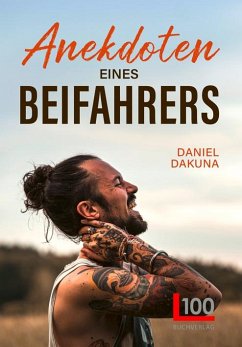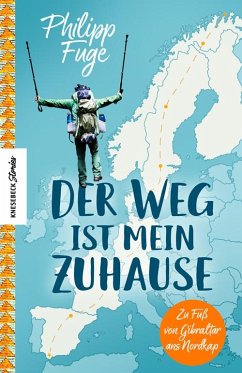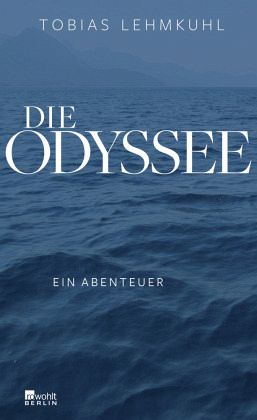
Die Odyssee
Ein Abenteuer
Mitarbeit: Ortmann, Frank
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Die Odyssee - ein Mythos, ein Abenteuer, ein Rätsel. Der genaue Verlauf der Irrfahrt ist unbekannt:_Die Segel setzte Odysseus in Troja, doch nachdem ein widriger Wind die Umrundung des Peloponnes vereitelte, verliert sich seine Spur_... ___Auch Tobias Lehmkuhl weiß noch nicht, wann und wo sein Abenteuer enden wird, als er von Trojas Ruinen aufs Mittelmeer hinausschaut. Wie Homers Held steht er vor einer Reise ins Ungewisse. Zufälle und Unwägbarkeiten führen Lehmkuhl nach Kea und Kythera, nach Neapel und Palermo, über Gibraltar und Malta schließlich doch nach Ithaka. Die «Odyssee» im G...
Die Odyssee - ein Mythos, ein Abenteuer, ein Rätsel. Der genaue Verlauf der Irrfahrt ist unbekannt:_Die Segel setzte Odysseus in Troja, doch nachdem ein widriger Wind die Umrundung des Peloponnes vereitelte, verliert sich seine Spur_... ___Auch Tobias Lehmkuhl weiß noch nicht, wann und wo sein Abenteuer enden wird, als er von Trojas Ruinen aufs Mittelmeer hinausschaut. Wie Homers Held steht er vor einer Reise ins Ungewisse. Zufälle und Unwägbarkeiten führen Lehmkuhl nach Kea und Kythera, nach Neapel und Palermo, über Gibraltar und Malta schließlich doch nach Ithaka. Die «Odyssee» im Gepäck, wandert er über Vulkan-Inseln und segelt durch die Ägäis, er verliebt sich in die Medina von Tanger, verpasst den Eingang zum Hades, lässt sich von Sirenen locken. Er freundet sich mit Grenzschützern an, lernt in Tunis vermeintliche Revolutionäre kennen, trifft Finanzinvestoren an der Costa de la Luz und besteigt den Vulkan Stromboli. Das Mittelmeer, unermesslich weit, unermesslich reich, erlebt Lehmkuhl als eine Welt, in der sich tausend Wege kreuzen, uralte und ganz neue, Wege von Kreuzfahrtschiffen und Flüchtlingsbooten, Fischern und Fernfahrer-Fähren. Eine packende Reise- und Abenteurergeschichte, die vom archaischen Zauber jener Landstriche zeugt, die als Wiege unserer Kultur gelten.
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote



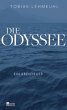

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.01.2014
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.01.2014